„Das darfst du nicht!“
Bärdel duckte sich instinktiv, als er die ärgerliche Stimme hörte. Er steckte mitten im Unterholz am Rande des Waldes unten in den Bergen, und dichtbelaubte Eichenbüsche, undurchdringlich für die Augen, trennten ihn von dem Sprecher, der sich anscheinend in offenem Gelände aufhielt. Da er nicht entdeckt werden wollte, verzichtete er darauf, sich näher heranzuschleichen. Das Rascheln der Blätter hätte ihn verraten können. Er vertraute allein auf seine Ohren, hockte sich nieder und schloß die Augen, um sich besser auf sein Gehör zu konzentrieren. „Anasazi“ weiterlesen
Morgenspaziergang
Morgenspaziergang
Auch in der neuen Welt wollten die Übersiedler selbstverständlich nicht auf lieb gewordene Gewohnheiten verzichten – schließlich waren sie konservative Europäer. So hatten Bärdel und Kulle ihre morgendlichen Spaziergänge wieder aufgenommen, sobald Kulles Pfoten verheilt waren (vergleiche: „Der erste Tag„). Anders als in Bärenleben aber bestand Bärdel darauf, in Kulles Nähe zu bleiben – er befürchtete weitere unbedachte Taten seines Freundes. Da er es verstand, seinen Mund zu halten, akzeptierte Kulle die Begleitung ohne irgend einen Kommentar.

Wie auch früher hielten sie eine feste Route ein: Ihr Weg führte sie bergauf über eine Wiese bis zu einem Bach, der unterhalb eines Geröllfeldes talabwärts plätscherte, dann parallel zum Hang durch einen lichten Aspenbestand und in einem sanften Bogen wieder hinunter zurück zur Höhle, die sie inzwischen „Zuhause“ nannten. Direkt hinter dem Wäldchen kreuzten sie dabei einen Fahrweg, der nach dehländischen Kriterien den Namen „Straße“ nicht verdiente, hierzulande aber durchaus als solche galt. Allerdings hatten sie noch nie erlebt, daß jemand diese sogenannte Straße benutzte. Bis heute.
Kulle wollte gerade, gedankenverloren wie immer, den Schutz der Bäume verlassen, als Bärdel nach ihm griff und ihn gerade noch am Schulterfell erwischte.
„Stop!“ flüsterte er. „Da ist doch was!“
Auf dem Fahrweg oder auf der Straße, jedenfalls auf dem festgefahrenen Lehm, stand ein Auto. Es sah so aus, als gehörte es nicht hierher in die Berge und als wollte es auch nicht hier sein. Der ehemals weiße PKW war lehmüberkrustet. Der linke Vorderreifen war platt, und unter dem Wagen breitete sich eine übelriechende schillernde Öllache aus. Die Scheiben waren dunkel getönt, aber dennoch konnten die beiden bei genauem Hinsehen erkennen, daß die Vordersitze besetzt waren.
„Menschen!“ Bärdels Stimme war noch leiser als vorhin. „Laß uns verschwinden!“
Kulle schüttelte jedoch den Kopf. Er sah Studienobjekte vor sich, keine unmittelbare Gefahr. „Nicht so eilig“, sagte er. „Die beiden schlafen doch, das sieht sogar eine Blindschleiche. Außerdem sieht es sehr so aus, als ob sie sich verirrt hätten – ihr Auto ist jedenfalls eine einzige Katastrophe. Ich möchte mir das näher ansehen.“

Bevor Bärdel reagieren konnte, sah Kulle sich das näher an, so wie er es verstand: Er ging ohne Umschweife auf das Auto zu und riß die Beifahrertür weit auf. Der Oberkörper eines jungen Mannes in dunkelblauem Anzug rutschte in den frei gewordenen Raum, und der Kopf wäre auf den harten Boden aufgeschlagen, hätte Kulle ihn nicht im letzten Moment aufgefangen.
„Oh“, sagte Kulle überrascht.
„Oh“, sagte der junge Mann und schlug die Augen auf. Er machte die Augen sofort wieder zu, und sein Gesicht nahm einen nachdenklichen Ausdruck an. Zuerst schien er skeptisch zu sein, aber dann begann er zu lächeln. Das Lächeln wurde immer strahlender, und als sein Mund so breit war, daß er die Ohren zu berühren schien, schlug er die Augen wieder auf. Er schaute Kulle voller Vertrauen an, hob die Arme hoch über seinen Kopf und senkte sie stufenweise wieder.
„Pay Lay Ale“, sagte er dabei.
„Kulle“, sagte Kulle, als er sich seinerseits vorstellte. Er war jedoch verwirrt – so einen merkwürdigen Namen hatte er noch nie gehört, und auch das Begrüßungsritual war ihm unbekannt.
Seine Antwort schien den jungen Mann nicht minder durcheinanderzubringen. Er schloß seine Augen wieder, rieb sich die Stirn, massierte sich die Schläfen und sah Kulle danach zum zweiten Mal an. Diesmal war sein Blick mißtrauischer und klarer zugleich. Er schüttelte den Kopf, als hätte er einen entsetzlichen Fehler begangen, und wandte sich der Gestalt auf dem Fahrersitz zu. Kulle beugte sich tiefer hinab, um besser sehen zu können.
Der Mann auf dem Fahrersitz war ebenso jung und ebenso weiß wie der Beifahrer und trug den gleichen blauen Anzug. Auch er schlief fest oder war vielleicht ohnmächtig, wie es sein Freund oder Kollege vor wenigen Minuten auch getan hatte oder gewesen war. Kräftiges Schütteln seines Beifahrers brachte ihn jedoch wieder zu Bewußtsein.
„Wasser!“ sagte er.
Damit konnten die Spaziergänger dienen. Seit dem Abenteuer des ersten Tages hatte Bärdel die Höhle nie wieder verlassen, ohne eine große Flasche Wasser mitzunehmen, und sei es auch nur für einen kurzen Ausflug. Und er hatte allen Bärenlebenern eingeschärft, es genauso zu halten. Also drängelte er sich jetzt nach vorne und reichte seine Flasche ins Auto.
„Bitte, trinkt ruhig, soviel ihr mögt. Wir haben genug.“ Selbstverständlich sprach Bärdel amerikanisches Englisch, aber als er sprach, merkte er, daß der junge Mann das nicht getan hatte. „Wasser“ hatte er verlangt. Buchstäblich. „Wasser“ auf deutsch.
Nachdem sowohl der Fahrer als auch sein Begleiter die Flasche gierig geleert hatten und sie, sichtlich beschämt wegen ihrer Gier, zurückgaben, begann Bärdel zu fragen. „Seid ihr Deutsche?“
Beide nickten.
„Verirrt?“ Beide nickten wieder.
„Touristen?“ Beide schüttelten den Kopf.
„Nein, wir sind Miss…“, begann der eine, aber der andere fiel ihm sofort ins Wort. „Dürfen wir euch etwas fragen?“ wollte er wissen.
“Selbstverständlich!“ sagte Kulle spontan. Er war überzeugt davon, daß es keine Frage gab, die er nicht beantworten konnte.
„Glaubt ihr an Gott?“
Das überraschte Kulle denn doch, allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dann aber holte er tief Luft. „Natürlich ni…“

„Natürlich nimmt diese Frage sich unter völlig Fremden ein wenig merkwürdig aus“, erklärte Bärdel anscheinend seelenruhig beinahe gleichzeitig. Die beiden Fremden sahen jedenfalls nicht, daß er Kulle heftig in die Seite knuffte, um ihn zum Schweigen zu bringen. „Es ist schließlich eine sehr persönliche Frage, aber ich will sie trotzdem beantworten: „Ja!“
Kulle blies ihm seinen heißen Atem ins Gesicht, als er ihn verblüfft ansah, aber Bärdel zwinkerte oder blinzelte kein bißchen. Stattdessen lächelte er die Fremden harmlos und strahlend an.
Die beiden strahlten zurück. Der Zusammenbruch ihres Autos, ihre offensichtliche Erschöpfung, vielleicht sogar Verletzungen – alles schien wie weggeblasen. „Wir auch!“ sagten sie im Chor. Und ebenfalls unisono: „Es ist schön, euch zu treffen, Brüder!“
„Gut, gut“, brummte Kulle, „dann sind wir uns also einig, und jeder kann wieder seiner Wege gehen.“ Er sah Bärdel auffordernd an. So neugierig er auch war, einen Disput mit religiös Verrückten, die auf einem Waldweg in einem zusammengebrochenen Auto saßen, hielt er für wenig fruchtbar. Bärdel schien jedoch anderer Meinung zu sein, denn er blieb wie angewurzelt stehen und wartete offenbar auf etwas. Er brauchte nicht viel Geduld zu haben.
„Die Botschaft der Bibel ist wunderbar, nicht wahr?“ fragte Fahrer.
Bärdel nickte mit verklärtem Lächeln. Kulle schaute mehr und mehr verwirrt drein.
„Aber…“ sagte Fahrer.
Bärdel runzelte die Stirn. Er schien nicht geneigt, irgend etwas auf die Bibel kommen zu lassen.Kulle sah jedoch, daß er schauspielerte. Er hatte zunehmend das Gefühl, an einer Schmierenkomödie teilzunehmen, die er allerdings nicht kannte.
„Aber was?“ wollte Bärdel wissen.
Seine augenscheinliche Skepsis veranlaßte Fahrer zu einer anderen Strategie. „Aber viele Menschen glauben leider, daß Gott sich heute nicht mehr offenbart“, erklärte er.
„Tut er das denn?“ Das war wieder Bärdel.
Kulle verlor die Geduld. Gut, abstrakt hatte er verstanden, was hier ablief. Die beiden jungen Männer wollten ihn und seinen Freund für ihre Religion keilen. Bärdel hatte das eher begriffen als er und wollte die beiden jetzt genüßlich und ausführlich vorführen. Aber Kulle hatte keine Lust, sich eine langatmige und bestimmt langweilige Religionsgemeinschaftsgründungs- oder Wundergeschichte anzuhören nach dem Schema: Jungfrau Maria erscheint drei armen Bauernmädchen, Gott erscheint viehhütendem Araberjungen, Nomade klettert bei schlechtem Wetter auf einen Berg – oder so ähnlich. Da er in Amerika war, war er sicher, daß in der Story der Beiden Gottvater samt Sohn, vielleicht auch noch begleitet von einer Dunstwolke, einem Knaben erschienen war, der vermutlich Miller oder Smith hieß – eigentlich also nichts Neues. Viel spannender war da doch, was die neue Religion zu bieten hatte.
„Also, das tut er bestimmt, wenn ich euch beide so ansehe. Wer mitten in der Wildnis über nichts anderes reden will als über Gott, dem ist er zweifellos erschienen!“ knurrte er. Bärdel sah ihn böse an, aber die beiden jungen Männer strahlten Kulle an, als sei er der Weihnachtsmann. „Na, dann erzählt mal – wie ist die Kosten-Nutzen-Relation?“
Bärdel fühlte sich genötigt zu übersetzen, als er die Verwirrung der Autofahrer bemerkte. „Mein Freund möchte gerne wissen, was der Gott, an den ihr glaubt, von seinen Dienern verlangt und wie er ihren Dienst belohnt. Mich interessiert das natürlich ebenfalls“, fügte er höflich hinzu.
Jetzt waren die beiden jungen Männer nicht mehr zu halten. Sie stiegen aus ihrem Auto, federnd und energiegeladen, kamen auf Bärdel und Kulle zu, legten ihnen jeweils einen Arm über die Schulter und übertrumpften sich wechselseitig mit ihren Erklärungen.
„Errichtung des Gottesreiches in Amerika…“
„Ewiges Leben im Himmel, in der Anwesenheit Gottes, mit eurer gesamten Familie…“
„…also mit allen Generationen…“
„…selbstverständlich ewige Fortführung der Ehe…“
„Ein glückliches, drogenfreies Leben auf dieser Erde…“
„Ein irdisches Leben ohne überflüssige Zweifel, denn wir gehorchen der Obrigkeit und dem Gesetz…“
„Beistand von geschulten Brüdern und Schwestern bei allen Problemen, mindestens einmal monatlich…“
Das verbale Trommelfeuer der beiden wollte zunächst gar nicht wieder aufhören, aber endlich verebbte ihr Redefluß.
„Das alles und noch mehr gibt es nur für den Zehnten“, sagte schließlich Fahrer. „Und ein bißchen Engagement“, fügte Beifahrer hinzu. Sie schauten Bärdel und Kulle erwartungsvoll an.
Kulle suchte den Blickkontakt mit Bärdel, und Bärdel nickte. Kulle hatte freie Bahn. Bärdel sah aus, als freute er sich kräftig auf ein ordentliches show-down, aber Kulle enttäuschte ihn.
„Hmhm“, machte er. „Wir sollten jetzt mal alle kräftig anfassen, den platten Reifen wechseln und euer Auto umdrehen, damit ihr wenigstens bergab rollen könnt und wieder zu euren Leuten kommt. Die Bremsen sind doch in Ordnung, oder?“
Die beiden Männer schwankten eine Weile zwischen dem Wunsch nach der Fortsetzung ihres theologischen Gesprächs und der vorgeschlagenen Rettungsmaßnahme hin und her, entschieden sich schließlich jedoch für Kulles Vorschlag. Als ihr Auto nach einer arbeitsamen Weile mit der Nase bergab zeigte, stiegen sie ein, bedankten sich, versprachen wiederzukommen, schalteten die Zündung ein, lösten die Bremse und legten den Leerlauf ein. Langsam, dann rascher begannen sie zu rollen. Bevor sie hinter der ersten Kurve verschwanden, leuchteten die Bremslichter auf.
Bärdel grinste Kulle an. „Das waren übrigens
LDS“, informierte er ihn. „Ich habe sie sofort erkannt, denn Ramses hat mir inzwischen einiges über sie erzählt. Deshalb dachte ich, daß ich sie dir bei dieser günstigen Gelegenheit gleich live vorführen sollte. Aber sag mal – seit wann bist du denn gegenüber religiösen Eiferern so nachsichtig, daß du auch noch dafür sorgst, daß sie sicher nach Hause kommen?“
„Nachsichtig?“ knurrte Kulle. „Bin ich das? Ihre Ölwanne ist leer, also können sie den Motor nicht anlassen. Der würde sich sofort festfressen. Ohne Motor haben sie keine Bremskraftverstärkung. Auch als LDS-Mitglied sollte man solche simpelsten technischen Sachverhalte kennen. Wenn sie heil unten ankommen wollen, dann brauchen sie also entweder kräftige Muskeln oder einen kräftigen Gott. Haben sie eins von beiden oder beides, dann wünsche ich ihnen ein glückliches drogenfreies Leben unter irgendeinem grausamen, aber selbstverständlich von Gott eingesetzten Diktator. Und wenn ihnen beides fehlt, ist das auch nicht schlimm, denn es erwartet sie ein nicht endendes Leben mit ihrer lieben Familie in Gottes Reich.“
„Um Gottes willen!“ flüsterte Bärdel entgeistert.
„Nun fang du nicht auch noch so an!“ fauchte Kulle. „Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, erstens. Wir können solche Typen hier oben nicht brauchen, zweitens. Und jetzt ist es Zeit zum Frühstücken.“
Identitätsdiebstahl

Manfred war glücklich. So glücklich, daß er in infantile Gewohnheiten zurückfiel und sich ertappte, wie er ein dummes altes Kinderlied vor sich hinbrummte: „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum.“ Dabei drückte er seinen neuen Laptop fest an sich. Die größte Hürde war genommen.
„Wo hast du das Ding denn her?“ wollte Bärdel mißtrauisch wissen, als er den flachen schwarzen Kasten zum ersten Mal zu Gesicht bekam.
„Den habe ich geschenkt bekommen“, sagte Manfred mit der unschuldvollsten Miene, zu der er fähig war. Das war fast gar nicht gelogen,1 Bärdel hatte dennoch das Gefühl, daß hier irgend etwas nicht stimmte, aber er war klug genug, vorsichtshalber nicht genauer nachzufragen.
Mit Hilfe des Laptops und seines „Text to Speach“- Programms lernten die Bären Englisch. Ihre hauptsächliche Hilfe dabei war allerdings Athabasca, die unermüdlich ihre Aussprache korrigierte und ihnen half, auch das kleinste Detail ihrer neuen Umgebung richtig zu benennen. Dabei lernte sie selbst übrigens ausgezeichnet Deutsch.
Natürlich hatten Manfred und seine Freunde den Computer nicht hauptsächlich deshalb „organisiert“, wie sie das nannten, um Englischlektionen abzuhalten. Er war der erste Baustein für den umfassenden Kontakt zur Außenwelt, den die Bären in Dehland gehabt hatten und den sie sich hier wieder wünschten. Einige Besuche in den umliegenden Siedlungen hatten die technische Ausrüstung um elektrische Leitungen, Glühbirnen und Steckdosen ergänzt, und Manfred hatte den nächstgelegenen Transformator angezapft.
Auch in Dehland war das die gängige Methode gewesen, Bedarfsartikel von geringem Wert zu besorgen, aber hier galt es, wesentlich vorsichtiger zu sein, das bemerkten die Bären bald. Die wenigen Menschen, die hier lebten, hatten zwar alle eine gut ausgestattete Werkstatt, aber das gesamte Inventar darin war so sorgfältig sortiert, daß jeder fehlende Gegenstand schnell auffallen mußte. Wer so ordentlich war, war entweder ein analer Charakter oder arm – für die Bären kam beides auf das gleiche heraus. Deshalb rief Manfred eines Nachmittags seine Freunde zusammen. Er kündigte an, es gebe Wichtiges zu besprechen, und so kamen alle. Auch Athabasca gesellte sich neugierig dazu.
„Das hier wird uns helfen, unsere Probleme zu lösen!“ verkündete Manfred der Versammlung. „Das hier“ war eine Büroklammer, eine verbogene Büroklammer, die er für alle sichtbar hochhielt.
Unwilliges Brummen und auch amüsiertes Kichern wurden laut. Da Manfred dergleichen erwartet hatte, ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen.
„Das soll kein Witz sein“, erklärte er geduldig. „Mit so einem kleinen Ding kann man hervorragend einfache Schlösser öffnen, ohne daß sie Schaden nehmen. Ich werde es euch zeigen!“

„Das brauchst du uns nicht zu zeigen, das weiß doch nun wirklich jeder!“ knurrte es unwillig aus einer Ecke. Manfred suchte den Sprecher, der erst jetzt den Kopf in die Höhe reckte, und entdeckte Kulle. Er seufzte. Kulle, der immer besserwisserische Kulle, würde seine Aufgabe nicht gerade erleichtern.
„Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie man das macht!“ Athabasca kam Manfred zu Hilfe. Aber der freute sich zu früh, denn sie fuhr fort: „Man braucht das auch nicht zu wissen. Niemand hier schließt sein Haus ab, das sollte euch inzwischen aufgefallen sein. Warum also soll man Schlösser knacken?“
Überall in der Runde nickten die Bären mit dem Kopf. Atti hatte völlig recht – sie hatten ihre kleinen Diebstähle begehen können, ohne durch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen behindert worden zu sein.
Manfred unterdrückte seinen aufkommenden Unwillen. „Schön und gut“, sagte er. „Aber, Atti, hast du schon mal einen Briefkasten aufgemacht?“
„Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Papier kann man nicht essen, oder ist das in Dehland anders?“ Wieder hatte sie die Lacher auf ihrer Seite.
Wortlos holte Manfred einen Stapel Papier hinter seinem Rücken hervor und warf ihn schwungvoll in die Versammlung. Briefe, Karten, Hefte und Faltblätter lösten sich voneinander und flatterten durch die Luft. Die wenigsten fielen zur Erde, denn die meistern wurden von den neugierigen Bären aufgefangen. „Das ist der typische Inhalt eines Briefkastens hier in der Gegend“, erklärte er. „Essen kann man den selbstverständlich nicht. Aber seht ihn euch doch mal an – vielleicht ist etwas Interessantes dabei!“
Eine Weile lang war nur noch das Rascheln von Papier zu hören. Dann mischte sich das eine oder andere unterdrückte Kichern darunter. Noch nie zuvor hatten die Bären Post gesehen, die zu über neunzig Prozent aus Überflüssigem bestand, nämlich aus Werbung. Besonders bunt und umfangreich stachen die Gartenkataloge hervor, aber auch die Hersteller von Werkzeugen und elektronischen Artikeln priesen ihre Produkte prahlerisch an. Daneben warben die regionalen Geschäfte mit ihren Sonderangeboten, von denen eines angeblich immer sensationeller und günstiger war als das andere. Wesentlich seriöser gab sich dagegen die Finanzwelt: Versicherungen gegen und für alles wie auch Geld machten das Leben angeblich kalkulierbar, angenehm und sorgenfrei.
„Guck mal hier, ein Plastikbär als Dekoration für den Garten!“
„Toll – auf diesen Fernseher für 69$ gibt es 99$ Rabatt!“
„Hmm, eine Platinum-Kreditkarte, für die man ein Jahr lang keine Gebühren zu zahlen braucht – die hätte ich gerne!“
„Ich auch“, erklärte Manfred. Und deshalb brauchen wir die da!“ Jetzt hielt er nicht nur eine, sondern mehrere verbogene Büroklammern hoch.
Kulle schüttelte enttäuscht den Kopf. Mit Manfred hatte er sich viel Mühe gegeben, sehr viel Mühe sogar. Er war ja auch ein intelligenter Bursche. Aber mit der Logik haperte es bei ihm, wie sich auch jetzt wieder zeigte. „Manfred“, sagte Kulle und legte all die Geduld in seine Stimme, zu der er fähig war – also gar keine. „Manfred, dieses Kreditkartenangebot ist nicht für dich, sondern für…“ Er griff nach dem Briefumschlag. „…für Michael A. Pratt in Castle Valley.“
Wortlos nahm Manfred ihm das Papier aus der Hand, zog einen Kugelschreiber hinter dem Ohr hervor und füllte einige Spalten aus. Dann gab er Kulle alles zurück, immer noch schweigend. Während Kulle las, murmelte er vor sich hin.
„Ja! Ich, Michael A. Pratt, will…Angebot annehmen…keine weiteren Verpflichtungen…keine Jahresgebühr…Castle Valley…Michael Pratt.“ Er holte tief Luft. „Urkundenfälschung!“ brummte er empört.
„Genau: Urkundenfälschung! Na und?“ Manfred ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
„Ich verstehe das alles nicht“, beschwerte sich ein Jungbär, der sich gerade erst von seiner Mutter getrennt hatte – genau genommen, hatte sie ihn weggejagt, weil er ihr lange genug am Fell gehangen hatte. Er hieß Del. Jetzt war er zum ersten Mal bei einer Erwachsenenversammlung, worauf er mächtig stolz war. Er hatte sich vorgenommen, sich ganz cool zu geben, und bis eben hatte das auch geklappt.
Als Del sich auf einmal im Mittelpunkt des Interesses bemerkte, wurde er blaß um die Schnauzenspitze, aber er sprach tapfer weiter. „Dieser Michael Pratt bekommt aufgrund von Manfreds Urkundenfälschung demnächst eine Kreditkarte zugeschickt – und was haben wir davon?“
„Manfred hielt seine Büroklammer zum dritten Mal hoch. „Wir klauen ihm die Kreditkarte, und dann haben wir sie, und dann können wir damit einkaufen.“ Er lächelte und war erkennbar stolz auf sich.
„Erst Urkundenfälschung und dann noch Betrug! Schwerer Betrug! Junge, wer hat dir das eigentlich beigebracht?“ Kulle war aufgesprungen, gestikulierte wild und zupfte an seiner Fliege. Er bot ein Bild reinster Empörung.
„Du“, antwortete Manfred seelenruhig. „Nein, natürlich nicht diese Aktion hier konkret.“ Er streckte vorbeugend den Arm aus, um Kulle notfalls abwehren zu können, falls der sich auf ihn stürzen wollte. „Aber abstrakt schon. Wer hat mir denn beigebracht, daß die Expropriateure expropriiert werden müssen? Genau das mache ich hier. Mr. Pratt passiert gar nichts. Wenn er seine erste Kreditkartenabrechnung bekommt, wird er der Firma mitteilen, daß er die entsprechende Karte gar nicht besitzt. Das war‘s. Geschädigt ist die Bank, und die hat nichts Besseres verdient. ‚Was ist der überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank‘, sagt Brecht. Und wer hat mich den Spruch gelehrt? Kulle!“
Kulle sank in sich zusammen und wieder auf den Boden zurück. Widerstreitende Gefühle spiegelten sich in seinem Gesicht. Zwar fühlte er sich gedemütigt, aber er war auch mächtig stolz auf seinen Schüler Manfred.
„Aber…“, begann Del schüchtern.
„Ja?“ fragte Manfred geduldig.
„Wenn dieser Mr. Pratt der Bank geschrieben hat, dann ist die Karte bestimmt ungültig oder steht auf einer schwarzen Liste, und wer damit einkauft, wird verhaftet. Oder täusche ich mich?“
„Du hast völlig recht. Diese eine Karte können wir nur für kurze Zeit gebrauchen, dann müssen wir sie wegwerfen. Aber es gibt hier viele Briefkästen und viele Kreditkartenangebote. Wir müssen sie nur nutzen. Und dafür brauchen wir diese Büroklammern. Kulle wird euch zeigen, wie man sie ansetzen muß. Er hat vorhin ja gesagt, daß er Experte darin ist.“
„Nun, Experte nicht gerade“, knurrte Kulle, ob des Lobes schon wieder ein wenig mit Manfred versöhnt. „Aber selbstverständlich kann ich…“ Er griff mit der rechten Pfote nach dem Drahtstück, ohne den Satz zu beenden, und faßte mit der anderen das einfache Schloß, das Manfred ihm hinreichte. Aller Augen folgten ihm gebannt, als er die Klammer ins Schlüsselloch einführte, ruckartig hin- und herbewegte – und abbrach. „Das…das ist…ein unbekannter Mechanismus, der…“

Athabasca erlöste ihn aus der peinlichen Situation. Mit spitzen Zähnen zog sie das eingeklemmte Drahtstück aus dem Schloß heraus, bog sich den Rest der Büroklammer zurecht, stocherte ein bißchen – und das Schloß war entriegelt. „Geht wirklich ganz leicht, wenn man die entsprechenden geschickten Finger hat“, kommentierte sie und lächelte spitzbübisch. „Frauenfinger. übrigens Frauen – ich nehme an dieser Versammlung im Auftrag aller jungen Bärinnen teil, um euch zu sagen, daß wir beim nächsten Mal ebenfalls alle kommen werden. Ich bin authorisiert zu sagen, daß wir auch die halbe Wache an den Briefkästen übernehmen und die Hälfte aller Unterschriften fälschen. Und wir fordern einen Computerkurs. Langfristig wollen wir programmieren lernen, zunächst aber werden wir uns mit einer Einführung ins Internet zufriedengeben. Dann können wir nämlich ebenfalls mit ‚unseren‘ Kreditkarten einkaufen.“
Das Brummen der Bären, das jetzt laut wurde, übertönte so manches Zähneknirschen. Aber die Ablehnung blieb versteckt, denn Athabascas Forderungen waren nur gerecht, und Bären geben Fairneß immer den Vorzug, auch wenn eigene Privilegien dadurch gefährdet werden. Kulles und Manfreds Zustimmung waren dagegen uneingeschränkt.
Kulle beschloß, Atti ein wenig theoretisch zu unterweisen, und hatte dabei ‚Die Entstehung der Familie, des Privateigentums und des Staates‘ von Engels und ‚Die Frau und der Sozialismus‘ von Bebel im Sinn. Manfred grinste übers ganze Gesicht und freute sich darauf, Athabasca zu unterrichten. Er war so begeistert von der Idee, daß er völlig vergaß, daß sie nicht allein sein würden.
Kulles Wahl
Heuschrecke, Hase, Erdhörnchen, Luchs und Coyote hockten zusammen und beratschlagten. Da kam Kulle des Wegs. Er grüßte höflich und fragte, ob er sich ihnen zugesellen dürfe. Die Fünf schauten einander an, nickten sich zu, lächelten geheimnisvoll und wiesen auf einen Baum direkt vor ihnen.
„Wir haben uns hier getroffen, weil wir jemanden brauchen, der für uns auf diesen Baum klettert“, zirpte Heuschrecke.
„Allerdings darf nicht jeder dort hinauf!“ ergänzte Erdhörnchen.
 „Nein, keineswegs jeder!“ lispelte Hase und wackelte aufgeregt mit den Ohren. „Nur der, dem wir es erlauben.“
„Nein, keineswegs jeder!“ lispelte Hase und wackelte aufgeregt mit den Ohren. „Nur der, dem wir es erlauben.“
„Nur der, der unsere Fragen zufriedenstellend beantwortet hat“, konkretisierte Luchs.
„Unsere keineswegs einfachen Fragen!“ blinzelte Coyote geheimnisvoll.
Kulle fühlte sich geschmeichelt. Natürlich wollte er gerne für die Versammelten auf diesen Baum klettern, und sei es nur, um ihnen zu beweisen, daß er ihre komplizierten Fragen beantworten konnte. Dennoch ließ ihn seine gute Erziehung zögern.
„Warum braucht ihr einen Fremden für diese Aufgabe?“ wollte er wissen. „Jeder von euch kann auf diesen Baum klettern, denke ich, denn er ist sehr schief gewachsen, und auch Hase und Coyote können auf seinem Stamm emporwandern. Und wer schwierige Fragen stellen kann, wird auch schwierige Antworten wissen.“
„Ja, das stimmt schon!“ gab Luchs zu. „Ich habe aber gerade drei kleine Kinder, die ich versorgen muß. Und wenn ich oben auf dem Baum bin, kann ich nicht für sie jagen.“
„Ich mache lieber hier unten Musik, um eine Frau zu finden, und verstecke mich dabei zwischen den Grashalmen“, flötete Heuschrecke. „Oben in den Bäumen gibt es entsetzlich viele Vögel, die in mir nur eins sehen: ein Nahrungsmittel!“
„Ich interessiere mich nicht für Bäume!“ mümmelte Hase. Erdhörnchen nickte energisch und schloß sich seiner Meinung an.
Kulle registrierte, daß Coyote schwieg. Er sah ihn auffordernd an, jedoch erfolgte keine Reaktion. Also mußte er fragen: „Und warum kletterst Du nicht auf den Baum?“
„Ich bin farbenblind“, sagte Coyote.
Kulle zuckte die Schultern. Natürlich war Coyote farbenblind. Alle Coyoten sind farbenblind, das weiß jedes Biologiebuch. Coyote benutze offenbar eine billige Ausrede, wie die anderen auch.
„Na schön. Keiner von Euch will auf den Baum, also werde ich für Euch raufklettern“, sagte er.
„Halt!“ Alle riefen wie aus einem Mund. „Halt! Wir haben Dir doch gesagt, daß Du erst hinauf darfst, nachdem Du unsere Fragen beantwortet hast!“
Kulle hatte diese Bedingung vergessen, beziehungsweise hatte er nicht mehr an sie geglaubt, nachdem er festgestellt hatte, daß niemand auf den Baum klettern wollte.
„Also gut! Fragt!“ sagte er. Kulle war ein geduldiger Bär.
„Bist Du Demokrat oder Republikaner?“ wollte Hase wissen.
Kulle fand, daß diese Frage indiskret war. Er hatte nicht die geringste Lust, jemandem, den er kaum kannte, seine innerste politische Überzeugung zu verraten. Außerdem verriet die Frage einen äußerst beschränkten politischen Horizont. Er ließ sich jedoch nichts anmerken.
„Ich bin Republikaner“, sagte er und entschied sich damit entsprechend der politischen Theorie für die weitergehende Variante, denn sie schloß immerhin die Existenz einer Monarchie aus.
„Schade!“ sagten Hase, Heuschrecke und Erdhörnchen.
 „Wir haben eigentlich immer Demokraten gewählt“, sagte Heuschrecke zur Erklärung, als Kulle verwundert guckte.
„Wir haben eigentlich immer Demokraten gewählt“, sagte Heuschrecke zur Erklärung, als Kulle verwundert guckte.
„Nicht immer!“ korrigierte Hase.
„Nein, natürlich nicht immer, Aber immer dann, wenn wir gewählt haben!“ konkretisierte Erdhörnchen. „Weil die Demokraten die besseren Sozialprogramme haben.“
Kulle hatte keine Zeit, um die Stirn zu runzeln, die geballte Faust auf ein imaginäres Rednerpult fallen zu lassen und seinem Publikum eine Grundsatzerklärung über politische Partizipation zukommen zu lassen. Er war vollauf damit beschäftigt, Luchs‘ nächste Frage zu beantworten.
„Was wirst Du für mich tun, nachdem ich Dich gewählt habe?“
„Nachdem Du mich gewählt hast, werde ich Deine Interessen vertreten“, sagte Kulle so langsam, als ob er den Satz aus einm Schulbuch ablesen würde. „In Deinem Fall heißt das, daß Du so viele Tiere jagen kannst, wie Du willst. Für den Fall, daß Dir Fleischfasern im Gebiß hängen bleiben, die Du mit Deiner Zunge allein nicht beseitigen kannst, werde ich einen Fonds einrichten, aus dem Deine möglichen Kosten für einen Zahnarzt bezahlt werden.“
Luchs nickte zufrieden und machte Hase Platz. Wie Kulle erwartet hatte, wollte auch Hase nur das eine von ihm wissen.
„Was wirst Du für mich tun, nachdem ich Dich gewählt habe?“
„Du sollst so viele grüne Wiesen haben, wie Du nur willst. Ich werde alle saftigen Wiesen einzäunen und unter Naturschutz stellen lassen, damit Du immer genug zu mümmeln hast. Raubtiere, die Dich bedrohen, werden erschossen; dafür wird eine Behörde sorgen, die ich einrichten werde.“
Kulle schaute sich um und wartete auf eine Reaktion, aber nichts dergleichen geschah. Stattdessen stellte Heuschrecke ihm die Frage, die er inzwischen sehr gut kannte.
„Für Dich werde ich ein Verbot aller Insektenvertilgungsmittel durchsetzen. Du darfst so viel Gras und sogenannte Nutzpflanzen und Wildkräuter fressen, wie Du möchtest.“
„Danke“, sagte Heuschrecke. „Ich glaube Dir übrigens kein Wort!“
„Na endlich!“ Kulle war ungemein erleichtert. „Ich habe schon befürchtet, daß Ihr hier alle völlig debil seid. Erstens widersprechen sich alle meine Versprechungen, oder, um es kurz zu machen, sie sind antagonistisch, wenn Ihr versteht, was ich meine. Zweitens wäre es völlig hirnrissig zu glauben, daß jemand, der auf einem Baum sitzt, etwas verändern oder veranlassen soll. Er hat von dort oben doch eine völlig falsche Perspektive und sieht nicht, welche Probleme es tatsächlich gibt. Ich bin froh, daß das dumme Spiel hiermit vorbei ist. Jetzt solltet Ihr mir mal erzählen, wass Ihr wirklich von mir wollt!“
„Wir möchten, daß Du für uns auf diesen Baum kletterst!“ sagte Coyote. „Ernsthaft! Wir alle sind nämlich sehr überzeugt von Dir. Natürlich wissen wir, daß Du deine Versprechen nicht halten kannst. Luchs, Hase und Heuschrecke haben entgegengesetzte Interessen, Du kannst einfach nicht jeden zufriedenstellen. Auch wird bestimmt niemand Lust haben, Luchs eine Krankenversicherung für seinen Zahnarzt zu bezahlen. Das alles wissen wir. Aber Du hast überzeugend gesagt, was eigentlich gut für jeden von uns wäre. Vielleicht nicht gut für uns alle. Um das herauszufinden, müßten wir uns mal ernsthaft zusammensetzen. Das würde bestimmt lange dauern und uns davon abhalten, zu jagen und Musik zu machen und Gras zu fressen und was es sonst noch für wichtige Dinge gibt. Das schaffen wir nicht, und deshalb übertragen wir es Dir, für unser Wohl zu sorgen, obwohl wir wissen, daß Du es nicht kannst. Und jetzt rauf mit Dir – Du hast keinen Gegenkandidaten!“
Coyote bleckte die Zähne, und Kulle, der sich zu den klugen, aber nicht unbedingt zu den tapferen Bären zählte, schlug seine Klauen in die Baumrinde und stieg langsam am Stamm hinauf. Coyote, Hase, Heuschrecke, Luchs und Erdhörnchen begleiteten seinen Aufstieg mit Beifall.
„Es lebe unsere neue Regierung!“ riefen sie im Chor.
Kulle suchte sich eine bequeme Astgabel und versuchte, es sich gemütlich zu machen und nach dieser Überraschung erst mal erholsam zu schlafen. Über ein Programm zu Erziehung der hiesigen Bevölkerung würde er nachdenken, wenn er wieder wach war.

Mountainbiking in Moab

„Hallo?“
„Hi John, hier ist Jim. Störe ich?“
„Überhaupt nicht, ich habe deinen Anruf doch erwartet. Na, was macht unser Patient?“
„Physisch geht es ihm wieder gut. Das Kerlchen ist zwar ein Bürohengst, aber eben beneidenswerte 25 Jahre jung. Er hat viel zu trinken bekommen und eine Kochsalzinfusion, das hat ihn wieder auf die Beine gebracht. Darüber hinaus habe ich ihn komplett untersucht, mit allen Schikanen – wäre zwar nicht nötig gewesen, ist aber, unter uns gesagt, gut für mein Budget. Der Knabe ist übrigens luxuriös krankenversichert, das weiß du doch sicher, oder?“
„Nein, wie sollte ich? Er war bei uns im Büro, um Anzeige zu erstatten. Auch wenn wir ihn für verrückt halten – das ist kein Grund, ihn zu filzen. Ist er nun verrückt, oder nicht?“
„Ehrlich gesagt, John, ich weiß es nicht. Er arbeitet bei den Feds in D.C., die entsprechenden Papiere hat er mir gezeigt. Jetzt hat er sich hochgearbeitet und seit Jahren den ersten nennenswerten Urlaub – und was macht er? Kauft sich das teuerste Mountainbike, das auf dem Markt ist, obwohl er überhaupt noch nie auf einem Fahrrad gesessen hat, um auf unseren berühmten Slickrockrouten herumzugondeln. Alles das natürlich mitten im Sommer, wenn wir Temperaturen von über 100 Grad Fahrenheit und 15% Luftfeuchtigkeit haben. Völlig untrainiert will er über Stock und Stein und mal so eben 3000 Fuß rauf und dasselbe wieder runter. Ich finde, das ist verrückt.“
„Komm, Jim, laß die dummen Scherze. So verrückt sind sie alle, und wenn sie es nicht wären, dann könnten wir unser schönes Moab, Utah vergessen und einen Zettel an den Straßenrand kleben: ‚Seit dem Uranboom in den 50er Jahren ist die Stadt leider bis auf weiteres geschlossen‘. Du weißt genau, was ich von dir wissen will!“
„Entschuldige. Also, der Junge ist in Grenzen intelligent. Er hatte Wasser mit auf seiner Tour durch die La Sals.  Allerdings zu wenig. Stattdessen hat er den technischen Kram mitgeschleppt, den man wohl für wichtig hält, wenn man ein Bürohengst aus D.C. ist. Seinen Pager zum Beispiel. Als ob er damit hier in der Wildnis für irgend jemanden erreichbar wäre. Und seinen Laptop. Das war gar nicht mal so dumm.“
Allerdings zu wenig. Stattdessen hat er den technischen Kram mitgeschleppt, den man wohl für wichtig hält, wenn man ein Bürohengst aus D.C. ist. Seinen Pager zum Beispiel. Als ob er damit hier in der Wildnis für irgend jemanden erreichbar wäre. Und seinen Laptop. Das war gar nicht mal so dumm.“
„Aber genau da fängt die Sache für mich an, blödsinnig zu werden, Jim. Was will jemand mit einem Computer auf einer Radtour in Südostutah, auf der er vermutlich keinen Menschen treffen wird, bestimmt aber keine Steckdose?“
„Entschuldige, aber als Sheriff solltest du schon wissen, was diese kleinen Wundermaschinen inzwischen können. GPS zum Beispiel. Global Positioning System. Du schaltest deinen Laptop ein, und der sagt dir, wo du gerade bist. Er zeigt dir Deinen Standpunkt auf einer Karte. Damit kommen selbst Deppen zurecht, die sich alleine mit Karte und Kompass nicht zurechtfinden. Es ist ganz einfach das ideale Orientierungssystem.“
„Quatsch! Ja, du hast schon recht, dieser technische Schnickschnack interessiert mich nicht genug. Vor der nächsten Wahl muß ich mich da noch ein bißchen – wie heißt das doch? – updaten. Kannst mir ja vielleicht helfen. Aber auch wenn ich ein technischer Idiot bin – es ist unmöglich, daß ich einen simplen Computer frage, wo ich bin, ohne daß der Computer seinerseits jemanden fragt, der es wissen muß. Woher soll ein kleiner schwarzer Plastikkasten wissen, wo er ist? Oder bin ich blöd?“
„Nein, John, du bist nicht blöd, sondern ich habe blöd erklärt. Du hast völlig recht. Der Laptop fragt jemanden, der es wissen muß, nämlich den GPS-Empfänger. Der erhält Signale von zwei Satelliten mit bekannter Position. Der Rest ist Geometrie. Wenn der Laptop darüber hinaus noch ein GSM-Modem hat, kann sein Besitzer sogar ohne Telefonkabel den Sheriff um Hilfe anmailen, falls er immer noch nicht alleine zurechtkommen sollte. Bis dann die Posse kommt, kann er sich die Zeit im Internet vertreiben.“
„Und das hat unser Patient gemacht, ja? Dir hat er das auch erzählt? Er hat seinen Laptop aus dem Rucksack geholt und seine Position bestimmt?“
„Genau das hat er mir erzählt.“
„Und dann?“
„Aber das weißt du doch schon alles.“
„Vielleicht, vielleicht auch nicht. Manche Menschen belügen die Polizei, aber einem Arzt sagen sie die Wahrheit. Also, wie geht die Geschichte weiter?“
„Er wollte seinen Laptop gerade wieder einpacken, als ihn eine Gruppe von Bären umringte. Fünfzehn, vielleicht auch zwanzig Tiere. Ein Bär erklärte ihm höflich, sie wollten nur seinen Computer, sonst nichts. Da er sich hoffnungslos unterlegten fühlte, tat er ihnen ihren Willen. Ohne GPS-Orientierungsmöglichkeit verfuhr er sich danach und kam dehydriert ins Sheriffsbüro, wo er Anzeige erstattete.“
„Glaubst du ihm?“
„Den ersten Teil ja, die Sache mit der Orientierung. Der Rest ist Unsinn. Bären in den La Sals werden ab und zu gesehen, aber immer als Einzelgänger, und natürlich können Bären nicht sprechen.“
„Was machst du jetzt mit ihm?“
„Solange er hier ist, bekommt er Beruhigungsmittel. Und meine eingehende Generaluntersuchung hat eine medizinisch interessante Gemengelage ergeben, die dazu führt, daß unser junger Freund unter extremer Belastung zu halluzinogenen Zuständen neigt – wer tut das nicht. Ich werde ihm das bescheinigen, er will schließlich etwas sehen für sein Geld. Wahrscheinlich hatte er wirklich ein Blackout, bedingt durch Dehydrierung, und hat den Laptop in die Büsche geworfen. Wenn sein Arbeitgeber das Gutachten in die Finger bekommt, ist er gefeuert. Schade für ihn, aber wir haben hier schließlich einen touristischen Ruf zu verteidigen.“
„Jim, ich danke dir!“
„Nichts zu danken, John. Ist schließlich alles für unsere geliebte Heimatstadt, nicht wahr?“
Der erste Tag
Die Bären, der Frosch und das Schwein hatten sich für die erste Nacht gemütlich eingerichtet, und die meisten hatten auch gut geschlafen. Einige allerdings, vor allem die jungen, zeigten am Morgen leicht rot geränderte Augen. Sie waren nachts neugierig aus der Höhle nach draußen gewandert und hatten sich an dem fremden Sternenhimmel, der so ungewohnt klar war und an dem der Halbmond auf dem Rücken lag, lange nicht sattsehen können. Aber auch sie krochen früh aus den Schlafecken – der erste Tag lag vor ihnen, und sie wollten keine Sekunde von ihm versäumen.
Wortlos häuften die Bärenfrauen kleine Beerenhügel in der Mitte der Höhle auf, aber sie wurden unangenehm laut, als einige Jungmänner sich auf die Nahrung stürzen wollten, als sei deren Bereitstellung eine Selbstverständlichkeit.
„Stop!“ sagte Dina. „Zuerst mal heißt das: ‚Danke!‘ Und zweitens möchte ich, daß wir jetzt alle zivilisiert gemeinsam frühstücken und sich nicht jeder heimlich irgendwohin verkrümelt und plötzlich verschwunden ist!“
„Danke!“ sagte Bärdel beschämt, und auch viele andere murmelten ähnliches oder nickten mit gesenkten Blicken. Sie schämten sich, weil die Frauen für sie alle gearbeitet hatten und weil Dina genau ihre Gedanken gelesen hatte. „Danke!“ wiederholte Bärdel. „Wo habt Ihr denn in der fremden Umgebung so schnell die vielen Beeren finden können?“
 „Ramses hat sie uns gezeigt. Sie wachsen massenhaft gleich hier hinter der Höhle. Serviceberries hat er sie genannt. Er sagt, es gebe viel davon, und alle Tiere liebten sie. Das Zeug schmeckt ziemlich sauer, aber das spricht für seinen hohen Gehalt an Vitamin C. Also: Laßt es euch schmecken!“
„Ramses hat sie uns gezeigt. Sie wachsen massenhaft gleich hier hinter der Höhle. Serviceberries hat er sie genannt. Er sagt, es gebe viel davon, und alle Tiere liebten sie. Das Zeug schmeckt ziemlich sauer, aber das spricht für seinen hohen Gehalt an Vitamin C. Also: Laßt es euch schmecken!“
„Hmhm“, machte Bärdel, nachdem er die erste Handvoll gegessen hatte und sich bemühte, nicht das Gesicht zu verziehen. Die Beeren war nicht nur ziemlich sauer, sie waren sehr sauer. „Interessant! Ein völlig neuer Geschmack! Wir sollten uns also auch bei Ramses für die leckere Mahlzeit bedanken.“
Die Mienen der meisten Bären drückten aus, daß sie die Bewertung „lecker“ keineswegs für zutreffend hielten, aber niemand widersprach. Stattdessen sahen sich alle suchend um – wo war Ramses?
„Ramses ist draußen“, sagte Tumu. „Er hat uns erklärt, daß er es als Frosch nicht gewohnt ist, sich in Höhlen aufzuhalten. Aber wir sollen ihn jederzeit rufen, wenn wir ihn brauchen.“ Sie behielt für sich, daß die Körperausdünstungen der Bären und des Schweins für den kleinen Frosch offenbar alles andere als angenehm waren.
Bärdel tappte zum Eingang und bat Ramses hereinzukommen. „Danke, daß du uns zu einem so … gesunden Frühstück verholfen hast. Wir hoffen, daß wir bald selbständiger werden und deine Hilfe nicht mehr ständig beanspruchen müssen. Den heutigen Tag werden wir für erste Erkundungen der näheren Umgebung benutzen. Gibt es etwas, worauf wir achten sollten?“
Hinter der Stirn des kleinen Frosches arbeitete es sichtbar. „Bewegt euch nicht so schnell, wie ihr möchtet“, sagte er schließlich. „Es wird ein paar Tage dauern, bis ihr euch an die dünne Luft hier oben gewöhnt habt. Trinkt viel – die Luftfeuchtigkeit ist hier viel geringer als in Dehland. Und sonst? Erschreckt keine Kuh, erschreckt vor keinem Cougar und hütet euch vor den LDS. Das war’s eigentlich schon.“
„Was ist ein Cougar?“
„Ich nehme sowieso keine Drogen.“
Was sind LDS?“
„Ich kenne nur LSD!“
Fragen und Kommentare purzelten durcheinander.
Ramses wedelte mit seinen Froscharmen, und Ruhe kehrte ein. „Entschuldigung! Ein Cougar ist ein Berglöwe, korrekter ein Puma. Ein paar von ihnen gibt es her oben. Wenn man sie stört, werden sie meist unangenehm. Sie schlafen tagsüber hoch oben in den Bäumen und jagen nachts. Eigentlich solltet ihr euch also nicht begegnen. LDS sind merkwürdige Heilige. Ich erkläre euch das besser später. Ich hätte sie jetzt noch gar nicht erwähnen sollen. Hütet euch vor den Menschen, wollte ich sagen – auch von denen gibt es ein paar hier oben.“
Die Neuankömmlinge waren mit Ramses‘ Erklärung zwar keineswegs zufrieden, denn sie wollten immer alles ganz genau wissen, aber da der Frosch deutlich machte, daß er im Moment mehr nicht sagen würde, gaben sie sich zufrieden, brummten und quiekten ihren halbwegs höflichen Dank in seine Richtung und verließen dann die Höhle, um endlich ihre Neugierde zu befriedigen.
Tumu blieb als letzte und beseitigte seufzend die wenigen Frühstücksreste. Neue Welt hin oder her – die alten Gewohnheiten hatten die Bärenlebener leider mitgebracht. Alle anderen waren ihr deshalb schon weit voraus, als sie endlich nach draußen trabte und schnuppernd den Kopf hob. Sofort stieg ihr den Geruch von Honig in die Nase. Die Quelle konnte nicht weit entfernt sein. Vorsichtig und nach allen Seiten witternd setzte sie sich in Bewegung.
Die anderen Bären hatten es so eilig gehabt, ihre neue Umgebung zu erforschen, daß sie von dem verführerischen Duft direkt vor ihrer Tür nicht das Geringste wahrgenommen hatten. Nur das Schwein hatte die süßen Düfte erschnüffelt, sich aber nicht weiter darum gekümmert, da Honig nicht zu den schweinischen Grundnahrungsmitteln zählt. Jetzt stakte es zögernd vorwärts und suchte hinter jedem Baum und Busch, ja selbst im hohen Gras Tarnung. Menschen gab es hier oben, Menschen und Kühe, hatte Ramses gesagt. Die Kühe mußten den Menschen gehören; die Menschen schlachteten die Kühe, und wer Kühe schlachtet, schlachtet auch Schweine. Das Schwein fürchtete sich und hatte das Gefühl, die weite Reise völlig umsonst gemacht zu haben.
Kulle stapfte im Sturmschritt dahin, so daß seine Fliege im selbst erzeugten Winde wehte, und achtete nicht auf Weg und Steg. Das war eigentlich kein Fehler, denn es gab dort, wo er entlanglief, weder Weg noch Steg.
 Aber Kulle achtete auch nicht auf die Richtung, in die er ging, er sah sich nicht nach Wasserquellen um, er war einfach blind für seine Umgebung. Erst jetzt, nein, exakt erst heute in den frühen Morgenstunden, war ihm klargeworden, was der Exodus aus Bärenleben für ihn bedeutete. Seine gesamte Bibliothek hatte er zurücklassen müssen, aber das war nicht das schlimmste. Dank seines hervorragenden Gedächtnisses kannte er die meisten wichtigen Werke auswendig. Das Schlimmste war, daß er, der bedeutende Wissenschaftler, in einen einsamen Gebirgsstock in einem unbekannten Land verbannt war, über dessen politökonomische Grundlagen er konkret kaum etwas wußte. Er wußte nur eines sicher: Wenn es ein Land auf der Welt gab, in dem keine sozialistische Revolution stattfinden würde, dann waren das die USA. Wütend über sich und seine Lage köpfte er die Blumen am Wegesrand, wohl wissend, daß der junge Goethe über ihn lachen würde, weil er sich genauso ohnmächtig zornig benahm wie Zeus, an den Prometheus nicht mehr glaubte, und das Wissen um sein unnützes Wissen machte ihn um so gereizter.
Aber Kulle achtete auch nicht auf die Richtung, in die er ging, er sah sich nicht nach Wasserquellen um, er war einfach blind für seine Umgebung. Erst jetzt, nein, exakt erst heute in den frühen Morgenstunden, war ihm klargeworden, was der Exodus aus Bärenleben für ihn bedeutete. Seine gesamte Bibliothek hatte er zurücklassen müssen, aber das war nicht das schlimmste. Dank seines hervorragenden Gedächtnisses kannte er die meisten wichtigen Werke auswendig. Das Schlimmste war, daß er, der bedeutende Wissenschaftler, in einen einsamen Gebirgsstock in einem unbekannten Land verbannt war, über dessen politökonomische Grundlagen er konkret kaum etwas wußte. Er wußte nur eines sicher: Wenn es ein Land auf der Welt gab, in dem keine sozialistische Revolution stattfinden würde, dann waren das die USA. Wütend über sich und seine Lage köpfte er die Blumen am Wegesrand, wohl wissend, daß der junge Goethe über ihn lachen würde, weil er sich genauso ohnmächtig zornig benahm wie Zeus, an den Prometheus nicht mehr glaubte, und das Wissen um sein unnützes Wissen machte ihn um so gereizter.
Manfred fühlte sich wesentlich glücklicher. Es galt, einen neuen Kontinent zu erforschen und sich mit den Mitteln des Technikers darin einzurichten. Er begutachtete seine Umgebung und entschied sich für den anstrengendsten Weg – bergauf, möglichst weit bergauf. Denn wer oben auf einem Berg stand, der konnte hinunter in die Täler schauen, und genau darauf kam es Manfred an.
Bärdel schien sich mit dem Schwein abgesprochen zu haben, was das Verhalten betraf, obwohl beide nichts voneinander wußten. Äußerst vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen und achtete darauf, ständig in Deckung zu bleiben. Er fürchtete sich vor einer Begegnung, vor einem Wiedersehen, obwohl er nie endgültige Klarheit darüber gewonnen hatte, ob das Treffen, an das er sich erinnerte, wirklich stattgefunden hatte. Bärdel erinnerte sich an seine erste Reise nach Amerika. (vgl. „Bärdel meets Smokey“.)
Dina hatte im Gegensatz zu ihm überhapt keine Sorgen. Sie war jung und hatte sich problemlos an die Höhe gewöhnt. Unbekümmert stöberte sie durch Wald und Gebüsch und stromerte über blumenbedeckte Wiesen, bis sie sich schließlich an einem blitzblanken springlebendigen Bergbach satt trank, sich auf den Rücken warf und in den blauen Himmel träumte.
—
Manfreds Herz hüpfte. Keine fünfzig Meter unter ihm stand eine Radiostation, und nicht weit davon entfernt ragten die Masten einer Hochspannungsleitung empor. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Manfred vermutete, daß sich das erst dann ändern würde, wenn irgendwo eine Fehlfunktion auftrat. Er grinste. Seinetwegen würden die Menschen nicht kommen müssen.
Bärdel griff sich an die Brust. Er hatte noch nie in seinem Leben Herzschmerzen gehabt und wußte nicht, wie sie sich anfühlten, aber jetzt war er sicher, daß er welche hatte. Dieser stechende, lähmende Schmerz konnte nur einen schweren Herzanfall bedeuten. Bewegungslos stand er vor einem Plakat, das flüchtig an eine Anschlagtafel geheftet war. „No Campfires“, sagte es, und für den Fall, daß jemand nicht lesen konnte, zeigte es das Bild eines Lagerfeuers, das von dicken roten Balken durchkreuzt war. Eine Ecke des Plakats war lose und flappte sanft im schwachen Wind. Darunter war immer dann, wenn die Ecke nach unten klappte, ein Feuerwehrhelm zu erkennen.
Dinas Herz schien einen Sprung zu machen und dann stillzustehen, als sie direkt neben sich plötzlich ein lautes Knacken und Rascheln hörte. Sie zwang sich, bewegungslos liegenzubleiben. Ob das die Menschen waren oder die LDS, von denen Ramses so geheimnisvoll gemurmelt hatte? Oder vielleicht ein Cougar, der heute beschlossen hatte, nicht tagsüber zu schlafen, sondern statttdessen neu angekommene Bärinnen zu fressen? Sie hielt die Augen fest geschlossen und war überzeugt davon daß niemand sie sehen konnte, denn sie selbst sah ja auch niemanden. Sie blinzelte auch kein kleines bißchen, als sie neben ihrem Ohr ein lautes Brummen hörte.
Das Schwein faßte sich nach langem Zögern ein Herz und näherte sich einer gemütlich aussehenden schwarzen Kuh mit weißem Kopf, die gemeinsam mit ihrem Kalb auf einer Waldlichtung graste. Ohne seine Deckung aufzugeben, erkundigte es sich nach den hiesigen Menschen und deren Verhalten. „Menschen?“ brummte die Kuh. „Kenn‘ ich nich‘.“ „Aber…“ wollte das Schwein einwenden, jedoch die Kuh schnitt ihm das Wort ab. „Hier gibs nur Mütter unn Kinner, unn Stiere natürlich. Wolln immer bloß das eine, die unverschämten Kerle. Unn Cowboys. Die sinn gefährlich, weil se dich nämlich verbrenn. Oder se machn dirn Loch ins Ohr ohne Betäubung, wie bei mir. Siehste?“ Sie wendete den Kopf, so daß das Schwein ihr rechtes Ohr sehen konnte, in dem ein rotes Plastikdreieck steckte, auf dem „77“ stand. „Aba die komm nur ganz selten. Unn so ne halbe Portion wie du kümmert die bestimmt nich.“ Damit schien die Konversation für die Kuh beendet zu sein, denn sie gab ihrem Kalb das Euter, als seien die beiden völlig allein auf der Welt. Schamhaft wandte das Schwein sich ab. Diese Kuh machte zwar einen ungebildeten Eindruck, aber vermutlich konnte man ihren Auskünften trauen.
Tumu sah sich den Bienenstock, den sie entdeckt hatte, lange an und bewegte dabei Kochrezepte in ihrem Herzen. Nach und nach versammelte sie ältere Bärinnen um sich, die sich in der näheren Umgebung aufgehalten hatten und schon bald wieder zur Höhle zurückkamen. Sie hatten, wie Tumu auch, nach den praktischen Dingen Ausschau gehalten, die für einen funktionierenden Haushalt notwendig sind. Sie tauschten ihr Wissen aus, schlugen einander kräftig auf die Schultern und machten sich dann daran, für den ersten Abend ein Festmahl zu improvisieren.
Als der Tisch nach stundenlanger Arbeit gedeckt war, brach auch schon die Dämmerung herein, und bevor es dunkel war, hatten sich alle wieder bei der Höhle versammelt. Hungrig waren die meisten, bärenhungrig, aber Tumu bestand darauf, daß sich alle sorgfältig die Pfoten wuschen, bevor sie das Essen anfaßten.
„In Dehland konntet ihr euch darauf berufen, daß das Wasser im Bach verschmutzt war, aber hier nicht!“ erklärte sie, und ihre Stimme war so entschlossen, daß niemand zu widersprechen wagte. Erst als alle fertig waren, wünschte sie „Guten Appetit“, und alle langten kräftig zu.
„Na, wie ist es dir ergangen?“ fragte Tumu ihren Mann zwischen zwei Bissen. „Oder willst du das erst später erzählen, bei der Versammlung, weil es von allgemeinem Interesse ist?“
Bärdel schüttelte den Kopf. „Später ganz bestimmt nicht, und am liebsten dir auch nicht. Ich habe Smokey gesucht. Nein, falsch, ich habe nach Beweisen dafür gesucht, daß es ihn nicht gibt. Aber es gibt ihn. Er ist immer noch überall auf den Plakaten, obwohl die zum Teil überklebt sind. Er trägt immer noch seinen komischen Hut oder einen Helm und sagt: „Only you can prevent forest fires!“ Wenn ich an mein Erlebnis von damals denke, dann wird mir ganz angst…“
Tumu seufzte. Sie wußte, daß Bärdel seine Halluzinationen von damals nach wie vor nicht richtig einordnete, daß er nicht wußte, ob sein Treffen mit Smokey Traum oder Realität gewesen war. Wenn sie ihm sagte, daß er krank war, phantasiert hatte, nickte er zwar immer, aber ohne Überzeugung. Sie mußte ihm einfach Zeit lassen. Hier würde er sich selbst davon überzeugen, daß Smokey nichts war als das Bild eines häßlichen, nicht existierenden Bären. Sie drückte seine Hand, schmiegte sich an ihn und schwieg.
„Die Kuh hat mir erzählt, daß es hier nur Cowboys gibt, keine Menschen, und daß die für mich ungefährlich sind“, hörte sie das Schwein sagen und schmunzelte. Nach wenigen Serkunden aber wurde sie unruhig. Eine solche Bemerkung konnte Kulle unmöglich unkorrigiert lassen, aber Kulle sagte nichts. Es paßte nicht zu Kulle, nichts zu sagen, wenn er die Chance dazu hatte.
Tumu setzte sich aufrecht. „Kulle?“ fragte sie. Niemand antwortete. „Kulle?“ Wieder nichts. „Kulle fehlt!“ rief Tumu und sprang auf.
„Unmöglich“, brummte die älteste Bärin, “ es sind alle da! Ich habe für jeden ein Stück Honigkuchen gebacken, und jetzt ist keines mehr da.“ Drohend hob sie die Stimme: „Oder hat jemand etwa zwei gegessen?“
Zuerst meldete sich niemand, aber dann schob Dina sich zögernd nach vorne. „Du?“ Tumu wollte es nicht glauben. Unsoziales Verhalten paßte nicht zu ihrer Freundin.
„Nein, ich nicht. Aber sie. Ich wollte sie als Überraschung bis nachher verstecken, aber das geht jetzt wohl nicht mehr. Darf ich vorstellen: Athabasca. Wir haben uns vorhin getroffen, oder besser, sie hat mich gefunden. Sie wohnt hier.“ Dina zog eine junge Schwarzbärin mir seidig glänzendem dunkelbraunen Fell an ihre Seite, die von allen überrascht angestarrt wurde und die höflich: „Guten Abend!“ sagte.

Bärdel erwachte aus seinen Grübeleien und erinnerte sich an seine Pflichten und vor allem an seinen Freund.
„Guten Abend im Namen aller, Athaca…“ begann er und verhedderte sich in dem fremden Namen.
„Athabasca“, sagte die Fremde freundlich. „Meine Freunde nennen mich Atti, das ist leichter. Danke für das Willkommen. Aber jetzt sollten wir zuerst an den Vermißten denken und ihn suchen. Das Gelände hier ist nicht ganz ungefährlich, wenn man sich nicht auskennt. Wohin ist er gegangen?“
Die Bären sahen einander fragend und anerkennend an. Noch nie war ein Neuankömmling so selbstbewußt aufgetreten, und schon gar keine Frau. Aber niemand von ihnen wußte, wohin Kulle gegangen war, und auch das Schwein und Ramses gaben ihre Unkenntnis zu.
„Bestimmt nach oben“, murmelte Bärdel schließlich. „Ich weiß nicht, wohin er ist, aber wenn er die Möglichkeit hat, wird Kulle immer nach oben gehen.“
„Dann sollten wir uns beeilen. Wenn ein paar von euch mit mir kommen könnten, wäre das gut. Aber jung und sportlich solltet ihr schon sein. Notfalls schaffe ich es übrigens auch alleine, denke ich.“ Athabascas Stimme war ganz ruhig, ganz anders als ihr Körper. Sie hatte sich bereits umgedreht und war fertig zum Losrennen.
Bärdel, Tumu und viele andere Ältere, die schon aufgesprungen waren, ließen sich wieder niederplumpsen. Sie kannte ihre Grenzen. Manfred dagegen war mir einigen anderen Jungbären sofort an Athabascas Seite. Die sah sich das Aufgebot an Freiwilligen an, nickte zustimmend und fegte wortlos wie ein dunkler Blitz davon in die Nacht, gefolgt von den anderen.
Auf dem Platz vor der Höhle kehrte Stille ein. Niemand aß mehr, obwohl noch genug Leckereien warteten. Sie hatten keinen Hunger. Wortlos starrten sie vor sich hin, auf die dunkle Erde oder in den Himmel. Viele rückten zusammen und suchten beieinander Trost. Sie konnten sich aneinander wärmen, während Kulle da draußen war, einsam und in Gefahr.
„Wenigstens scheint der Mond“, murmelte Bärdel schließlich. Nicht weit von ihm entfernt hockte Ramses wie ein Häufchen Unglück; sein Bauch schimmerte hellgelb im fahlen Licht. „Sag mal, du kennst dich doch hier aus, oder nicht? Wohin ist Kulle gegangen, wenn er aufwärts gegangen ist?“
Ramses schien sich zu winden. „Auf den Berg…“ Er merkte, wie dumm seine Antwort war. „Die meisten Berge hier bestehen in Gipfelnähe aus losem Fels. Talus sagt man hier. Meist sind das scharfkantige Platten ohne stabiles Gleichgewicht, die unter dem Gewicht eines Bergsteigers nachgeben. Die Lehne zwischen zwei Bergen ist manchmal sehr schmal, weniger als 30 Zentimer, und wenn sie aus solchen Platten besteht, dann nennt man das hier die „Rasiermesserfalle“. Wenn Kulle von hier aus aufgestiegen ist, dann läuft er genau auf so einen „razorfang“ zu…“ Ramses‘ Stimme war immer leiser georden, und als er verstummte, herrschte Totenstille.
Lange. Sehr lange. Bis endlich in der Ferne Zweige knackten, Füße tappten, Bären brummten und schimpften. Die Zurückgebliebenen sprangen auf und starrten ihnen entgegen. Athabasca erschien als erste, überhaupt nicht angestrengt und fröhlich lächelnd.
„Wir haben ihn rechtzeitig gefunden“, sagte sie. „Was er jetzt braucht, sind ein paar ordentlich adstringierende Blätterkompressen für seine aufgeschundenen Pfoten und viel zu trinken. Und der Rest der Rettungsmannschaft hat auch ein bißchen Pflege nötig, wie es scheint.“
Hinter ihr tauchte jetzt Kulle auf, gestützt von zwei asthmatisch keuchenden Jungbären. Als sie ihn losließen, schwankte er und setzte sich vorsichtshalber schnell auf die Erde. Seine beiden Helfer taten es ihm nach.
„Entschuldigung!“ brummte Kulle. Alle horchten auf, denn es gehörte zu den ungewöhnlichsten Vorkommnissen in ihrem Gemeinschaftsleben, daß Kulle sich entschuldigte. Und er wiederholte sich sogar!
„Entschuldigung! Es tut mir leid, daß ich euch Mühe bereitet habe. Ich bin ein Dummbär, weil ich ohne zu überlegen losgerannt bin. Wenn sie nicht gewesen wäre… Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie nicht gekommen wäre. Wozu bin ich denn hier nutze? Entwurzelt, meiner gesellschaftlichen Basis entkleidet! Ein Forscher ohne Gegenstand! Faux frais für euch! Ein leerer Spiegel, der die Wirklichkeit nicht zu spiegeln vermag! Ein…“
Bärdel war dankbar, daß Kulle schnell wieder in sein unverständliches soziologisches Kauderwelsch verfiel, weil er sonst wohl zu weinen angefangen hätte. Aber er verstand, was seinen Freund bewegte, und er litt darunter, daß er nicht wußte, wie er ihm helfen sollte. Da meldete sich Manfred zu Wort.
Manfred war zerschunden, seine Pfoten bluteten kaum weniger als die Kulles, und er war noch immer außer Atem. Trotz seines Kummers mußte Bärdel insgeheim schmunzeln. Sein Sohn hatte sich erkennbar nicht geschont, um der neuen Schönheit zu imponieren. „Wir sollten Kulle dankbar dafür sein, daß er heute für uns alle die Frage gestellt hat, um die wir uns ohne ihn vielleicht noch eine Weile lang herumgedrückt hätten. Die Frage lautet: Was wollen wir hier? Wollen wir uns verstecken?“
Die Versammlung nickte heftig – genau deshalb waren sie hergekommen.
„Ja, natürlich wollen wir uns verstecken, aber ist das alles? Wollen wir dumpf jeden Morgen erwachen, jeden Abend ins Bett gehen und zwischendurch darauf achten, daß wir nicht wahrgenommen werden? Soll das alles sein?“
Das Schwein nickte begeistert, aber die meisten Bären schüttelten verneinend den Kopf.
„Nein, das kann nicht alles sein. Wir Bären – und alle, die gemeinsam mit uns leben wollen – sind intelligente Wesen, neugierige Wesen. Wir wollen lernen, Wissen erwerben und Wissen weitergeben. Wir wollen die kritische Auseinandersetzung. Zu all dem haben wir seit gestern eine völlig neue Chance, denn wir sind wie neu geboren, sind in eine unbekannte Umgebung geworfen. Wir können, ja, wir müssen sie studieren, bewerten, vielleicht auch korrigieren, wenn die objektiven Umstände es erfordern. Wir haben gar keine andere Wahl!“
Die meisten Mitglieder der Versammlung hingen mit glühenden Augen an Manfreds Lippen. Bärdel allerdings blickte skeptisch. Er hatte das Gefühl, daß hier etwas nicht stimmte, wußte allerdings nicht, was. Tumu nahm sich fest vor, ihrem Sohn mal wieder den Hintern zu versohlen, auch wenn er diesem Alter eigentlich längst entwachsen war.
 Und Kulle hatte all seine Schmerzen vergessen und grinste – georgische Rhetorik konnte der Junge jetzt, das bewies er nicht zum ersten Mal. Es war Zeit, daß er ihn in die höheren Weihen einführte.
Und Kulle hatte all seine Schmerzen vergessen und grinste – georgische Rhetorik konnte der Junge jetzt, das bewies er nicht zum ersten Mal. Es war Zeit, daß er ihn in die höheren Weihen einführte.„Wir leben inmitten von Menschen, wie bisher. Auch wenn die Bevölkerungsdichte hier geringer ist, Menschen bestimmen unsere Lebensbedingungen. Wir brauchen Kenntnisse über die Menschen, wie bisher. Diese Kenntnisse werden uns überleben lassen und unsere Neugier befriedigen, und diese Kenntnisse werden den Intellektuellen unter uns – wie Kulle – wieder das Selbstwertgefühl verleihen, das…“
„Schluß!“ sagte Kulle. Er sagte es ungewohnt gemütlich, aber Manfred verstand das Signal nur zu gut. Er hatte irgend einen Fehler gemacht, sonst wäre sein Rhetoriklehrer ihm nicht in die Parade gefahren. Er wußte allerdings nicht, welchen.
„Schluß! Ich sehe, hier ist noch viel zu essen, und ihr seid bestimmt hungrig. Ich übrigens auch. Wir sollten also besser essen, anstatt lange Reden zu halten. Und dann sollten wir vielleicht schlafen. Ich zumindest. Ich bin hundemüde, oder besser bärenmüde, das wird mir wohl jeder von euch glauben. Nach dem Essen oder morgen – wie ihr wollt – könnt ihr dann überlegen, wie wir hier unser Informationsnetz aufbauen. Manfred hat da bestimmt schon Ideen, wie ich ihn kenne. Aber jetzt erstmal: Guten Appetit!“
Niemand widersprach. Erleichtert machten sich alle über das Essen her, bis auch kein Krümel mehr übrig war, und danach ging einer nach dem anderen schlafen.
Ramses, den das Buffett nicht reizte, schnappte sich ein Glühwürmchen, das über die Wiese tanzte, und sog gedankenvoll an einem Flügel. Tussi hatte ihm gesagt, daß die Entscheidungen in Bärenleben anarchisch gefällt werden, und er wunderte sich über diese Aussage, bis auch er schließlich einschlief.
Exodus

Herrn Bär
Bärenleben
Falls unzustellbar – zurück!
Bärdel wußte natürlich, daß die Menschen Vornamen hatten, daß sie in Häusern mit Hausnummern wohnten und daß eine Behörde den Orten, in denen sie wohnten, fünfstelligen Nummern gegeben hatte, damit die Briefe, die sie einander schickten, auch tatsächlich ankamen. All das fehlte hier. Also mußte ein besonders intelligenter Briefträger für den Bezirk Bärenleben zuständig sein, wenn er sein Ziel auch ohne diese Hilfen gefunden hatte. Aber das war nicht das Hauptproblem.
Um Bärenleben zu finden, mußte der Briefträger wissen, daß es Bärenleben gab. Um einen Brief nach Bärenleben zu schreiben, mußte der Absender wissen, daß Bärenleben existierte. Er mußte ebenfalls wissen, daß Bärdel – oder andere Bären – dort wohnten, deren Namen er allerdings nicht kannte. Vielleicht vermutete der Absender das alles auch nur. Warum sonst sollte auf dem Umschlag stehen: „Falls unzustellbar – zurück!“?
Aber auch eine vermutete Existenz von Bärenleben war schlimm genug – bisher hatten seine Bewohner geglaubt, sich perfekt unsichtbar gemacht zu haben.
Er untersuchte den Brief genauer. Neben der ordentlich entwerteten Briefmarke war ein Stempel sichtbar, schlecht und flüchtig aufgedrückt, aber mit Mühe doch zu entziffern. „Finanzamt Nord-Dehland“ buchstabierte Bärdel zusammen. Finanzamt? Das nächste Rätsel war gegeben: Was hatten die Bewohner von Bärenleben mit Steuern zu tun? Wie alle Bären war natürlich auch Bärdel extrem neugierig und wäre deshalb beinahe dem Impuls gefolgt, den Briefumschlag aufzureißen, aber er beherrschte sich im letzen Moment. Wenn er den Brief öffnete, würde er ihn akzeptieren – und er wußte nicht, ob das klug wäre.
Er wollte das nicht allein entscheiden. Deshalb machte er sich auf die Suche nach Kulle.
Kulle hatte ähnliche Gewohnheiten wie er selbst.
Während alle anderen Bären noch gemütlich in der Höhle pennten und erst draußen erschienen, nachdem die Sonne der norddehländischen Tiefebene
wenigstens ein bißchen Wärme spendiert hatte, genoß Kulle ebenso wie er selbst gerne die Dämmerung, beobachtete, wie sich Farben aus dem Grau schälten, wie die Tautropfen auf den Blättern in allen Regenbogenfarben
zu funkeln begannen und wie die Mittiere des Waldes den Tag begrüßten. Bei ihren Morgenspaziergängen gingen sie einander gewöhnlich aus dem Weg, weil jeder von ihnen allein sein wollte. Wollte man einander erfolgreich aus dem Weg gehen, dann mußte man wissen, wo der andere war. Selbstverständlich kannte Bärdel Kulles Route, und deshalb fand er ihn schnell.

„Guten Morgen!“ sagte er nochmals. „Ich weiß, daß ich Dich störe, aber Du mußt Dir das hier unbedingt ansehen.“
Damit streckte er Kulle den Brief entgegen. Der blieb unwillig stehen und starrte nicht den Brief, sondern Bärdel böse an.
halten! Das liegt nämlich daran, daß…“ „Entschuldige!“ unterbrach Bärdel ihn. „Aber wenn ich diesen Brief, den ich hier in der Hand halte, richtig bewerte, dann sind Deine Überlegungen vielleicht bald überflüssig, weil es keine
Bären mehr geben wird. Wir haben ein reales Problem, kein philosophisches! Man hat uns entdeckt!“
„Unmöglich!“ Kulle ärgerte sich sofort über seine von Emotionen und nicht von Vernunft gesteuerte Reaktion und fragte schnell weiter, um sein ungeschicktes Verhalten zu zu vertuschen: „Wer?“ „Das Finanzamt. Wahrscheinlich jedenfalls.“
Zum zweiten Mal reichte er Kulle den Brief, und diesmal nahm der ihn und beäugte ihn ebenso mißtrauisch, wie Bärdel es wenige Minuten zuvor getan hatte.
„Ich wollte Dich fragen, ob wir ihn aufmachen sollen“, sagte Bärdel.
Kulle wiegte seinen dicken Kopf und strich dabei mit seiner rechten Pranke über seine Fliege, bei ihm ein Zeichen höchster Konzentration. Es dauerte eine Weile, bis er antwortete.
„Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können den Brief vernichten und ihn vorher lesen oder auch nicht. Damit stellen wir uns tot, wobei wir entweder wissen, was man von uns will, oder nicht. Wissen ist immer gut, also sollten wir, wenn wir uns für diese Möglichkeit entscheiden, den Brief aufmachen,
bevor wir ihn vergraben oder verbrennen. Die Gefahr bei diesem Verfahren ist, daß wir einen zweiten Brief bekommen und dann wieder vor demselben Problem stehen. Bei der Menschenpost gehen schon mal Briefe verloren, aber daß das zweimal hintereinander passiert, ist wenig wahrscheinlich. Beim zweiten Brief müßten wir also irgendwie reagieren. Wir haben natürlich noch eine andere Möglichkeit: Wir machen diesen Brief auf und reagieren darauf.“
Weder Kulle noch Bärdel hatten eine Ahnung, wie eine solche Reaktion aussehen könnte. Momentan war diese Frage auch zweitrangig. Sie sahen sich an und nickten sich zu. Der Brief würde geöffnet werden, und zwar sofort.
Kulle zerrupfte das Kuvert und zog einen einzelnen Bogen Papier hervor. Er begann stumm zu lesen, aber Bärdel knuffte ihn unsanft in die Flanke.
„Halt den Brief gefälligst so, daß ich mitlesen kann, oder lies vor!
„Sehr geehrter Herr Bär,
der Steuererklärung des Verbandes der Chemischen Industrie aus 1996 haben wir entnommen, daß Sie von diesem Verband Geldmittel in Höhe von DM 10 000 000,00 erhalten haben. Bisher haben Sie diese Summe unseren Unterlagen gemäß nicht versteuert. Hiermit
werden Sie aufgefordert, die steuerliche Veranlagung
der o. g. Einkünfte binnen einer Frist von 30 Tagen vorzunehmen. Es gilt das Datum des Poststempels.
Im Auftrage
Beutler
Finanzinspektor“
„Hm!“ brummte Bärdel. „Diese Menschen!“
Wäre Bärdel ein Mensch, hätte er sicherlich „Diese Schweine“ gesagt. Er meinte den Verband der Chemischen Industrie. Der hatte also damals, als die Menschen Bärenleben zu nahe rückten, weil Dehland in einer Wirtschaftskrise steckte, und als Bärdel mit einem Trick Geld besorgte, mit dessen Hilfe sie auf Distanz gehalten werden konnten (vgl. „Außerordentliches Beispiel…“) , die zehn Millionen nicht aus irgend einer schwarzen Kasse genommen, sondern offiziell als Ausgaben verbucht.
Ratlos sah er Kulle an. „Und? Was machen wir jetzt?“
Kulle zerknautschte seine Fliege, so daß ihm schließlich nur noch ein zerrupfter Stofffetzen um den Hals hing.
Ein besseres Zeichen dafür, daß ihm auf diese Frage keine Antwort einfiel, konnte es nicht geben.
„Also Bärenrat!“ sagte Bärdel energisch.
„Und nicht erst heute Abend, zur gewohnten Stunde, sondern sofort!“
Kulle nickte wortlos und ging nach links. Bärdel wandte sich deshalb nach rechts. Die anderen Bären und das Schwein mußten inzwischen aufgewacht
und ausgeschwärmt sein. Wenn sie in entgegengesetzten Halbkreisen auf Bärenleben zugingen, würden sie sie alle treffen.
Eine halbe Stunde später war die Versammlung vollzählig.
Unruhiges Gemurmel füllte die große Höhle. Alle spürten, daß etwas Außerordentliches, etwas Bedrohliches geschehen sein mußte, wenn
sie zur besten Frühstückszeit vom Beerensammeln abgehalten wurden.
Bärdel berichtete von dem Brief des Finanzamts und erzählte für die Jüngeren dessen Vorgeschichte.
„Wir sind also entdeckt,“ schloß er.
„Ich weiß zwar nicht, wie das geschehen konnte, aber Bärenleben ist enttarnt. Wir können noch eine Weile die Augen davor verschließen, uns totstellen, indem wir zum Beispiel so tun, als hätten wir diesen Brief nie erhalten, aber es wird ein zweiter Brief folgen, wie ich die Menschen kenne. Und ein dritter. Danach kommt dann die Polizei, die Krisenreaktionskräfte, was weiß ich.
Danach kommt der Tod.“
Melodramatische Auftritte hatten bisher nie zu Bärdels Repertoire gehört. Um so beeindruckter war die Versammlung von seinen letzten Worten. Ein langes Schweigen folgte.
„Könntet ihr…“ das Schwein räusperte sich und entfernte den Kloß aus seiner Kehle.

„Könnten wir denn nicht einfach bezahlen und danach wieder unsere Ruhe haben?“
„Können wir nicht!“ antwortete Manfred.
Da er für die meisten Innovationen in Bärenleben verantwortlich war, die sich nicht sämtlich mit Hilfe von „Anleihen“ bei den Menschen realisieren ließen, war er zum Schatzmeister des Dorfes ernannt worden.
„Von der milden Gabe der chemischen Industrie damals haben wir fünf Mark auf unserem Konto gelassen – für alle Fälle, wie wir damals dachten. Heute zeigt sich, daß wir dabei mindestens einen Fall vergessen haben. Darüber hinaus liegen in meiner Kasse einhundertundsieben Mark und zweiundfünfzig Pfennige, über deren Herkunft ich im Moment keine Rechenschaft geben kann.“
Trotz der angespannten Situation schmunzelten die Bären – jeder wußte, wie leicht es war, von einem zufälligen Besuch in den Häusern der Menschen ein bisschen Kleingeld mitzubringen.
„Abgesehen davon,“ warf Kulle ein, „änderte eine Zahlung unsererseits nichts an der Tatsache, daß man uns entdeckt hat.“ Er hatte seine Fliege wieder geglättet und schien sich ein wenig gefaßt zu haben.
„Was machen wir also?“ Tumu bemühte sich um Ruhe, aber ihre Stimme zitterte bei der Frage.
„Patria o muerte!“ brüllte einer der jungen Bären plötzlich los. Er war ein intelligenter Bursche, was Kulle veranlaßt hatte, ihm in seiner freien Zeit ein paar Lektionen in kommunistischer Theorie zu erteilen. Jetzt zog der Lehrer indigniert die Augenbrauen hoch.
„Dummer Junge!“ brummte er. „Kampf ist nicht Selbstmord – ich dachte, ich hätte dir das beigebracht!“
Der Jungbär sank in sich zusammen, und Schweigen breitete sich aus.
„Was machen wir also?“ Bei der Wiederholung ihrer Frage zitterte Tumus Stimme noch stärker, aber sie fuhr tapfer fort.
„Ich weiß jetzt, was wir alles nicht machen können: Wir können uns nicht verstecken, wir können nicht zahlen, und wir können nicht kämpfen. Was also können wir?“
Wieder herrschte Schweigen, langes Schweigen. Schließlich quiekte das Schwein in die lastende Stille: „Als die Menschen mich verfolgt haben und mich aufessen wollten, da bin ich weggelaufen. Bei euch habe ich Schutz gefunden. Könnten wir nicht alle zusammen weglaufen und bei irgend jemandem Schutz finden?“
Brummen erfüllte die Höhle. Es war ein Brummen der Nachdenklichkeit. Viele Bären hatten dem Schwein, dem politischen Asylanten, bisher lediglich höfliche Neutralität entgegengebracht. Aber das Schwein schien gar nicht dumm zu sein. Vielleicht bedeutete seine Idee die Rettung.
„Wohin denn weglaufen?“ wollte ein alter griesgrämiger Bär schließlich wissen. Er konnte sich nicht vorstellen, woanders als in Bärenleben zu leben.
Die Frage schien einen Damm einzureißen. Viele Bären unternehmen in ihren Tagträumen gerne Fantasiereisen, und seit die Bärenlebener Kontakt
zu den Menschen hatten, lasen sie mit Genuß Reiseprospekte. An attraktiven Zielen mangelte es also nicht.
„Auf die Malediven…“
„Nach Kanada…“
„Ich wollte schon immer mal in die Namib…“
„Outback Australia, da findet uns niemand…“
„Lieber Neuseeland, das ist gleich nebenan…“
„Also ich…“
„Stop!“
Der Ruf kam gleichzeitig von Tumu, Manfred, Kulle und Bärdel, und nur weil sie gleichzeitig schrien, konnten sie sich gegen das Stimmenwirrwar durchsetzen.
„Stop!“ sagte Kulle nochmals und sah seine drei Mitrufer an, um die Stimmung zu testen. Tumu schaute hoffnungslos, Manfred abenteuerlustig, Bärdel resigniert.
Kulle ließ sich nichts anmerken, als er fortfuhr:
„In Outback Australia findet uns jeder, weil dort keine Bären leben. Ebensowenig in der Namib, in Neuseeland oder auf den Malediven. Kanada ist schon besser. Als erstes ist es also wichtig, uns ein Ziel auszusuchen, und zwar ein realistisches. Also Kanada, die USA, vielleicht die Karpaten. Ich nehme nicht an, daß wir noch einmal unser Glück in so enger Tuchfühlung mit den Menschen versuchen wollen wie hier. Das sind also die möglichen Ziele. Damit verbunden ist ein weiteres Problem, nämlich das des Transports. Wir müssen überlegen, wie wir ein mögliches Zielgebiet erreichen können. Ich schlage deshalb vor, drei Arbeitsgruppen einzurichten, und jeder Bär nimmt an einer teil:
- Nahrungssuche
- mögliche Zielgebiete
- mögliche Wege dorthin.
Gibt es andere Vorschläge?“
Es gab keine anderen Vorschläge, wohl aber zwei Fragen.
Das Schwein wollte wissen, bei welcher Arbeitsgruppe es mitarbeiten solle, und erhielt die Antwort, es könne sich eine aussuchen.
Tumu fragte besorgt, ob sie denn für ein solch sorgfältiges Vorgehen genügend Zeit hätten, und Bärdel antwortete: „Sankt Bürokratius arbeitet manchmal sorgfältig, aber immer langsam.“
Tumu verstand die Antwort zwar nicht recht, aber weil sie ihrem Mann vertraute, beruhigte sie sich. Zwei Tage später traf sich die Sippe wieder in
der Höhle. Alle waren hungrig. Zwar hatte die Arbeitsgruppe „Nahrungssuche“ bis zur Erschöpfung gearbeitet, aber das Futter reicht einfach nicht aus, wenn ein Bär zwei andere ernähren muß.
Dennoch beklagte sich niemand. Alle wußten, daß jetzt geistige Anstrengungen Vorrang hatten, wenn sie es schaffen wollten, aus ihrer gefährlichen Lage herauszufinden.
Tumus beste Freundin, Dina, erstattete Bericht für die AG „Zielgebiete“:
„Als Braunbären kommen für uns weder extreme Höhenlagen noch tropische Gebiete in Frage. Ebenfalls sollte unser künftiges Siedlungsgebiet
eine kleine Menschenpopulation aufweisen, um Problemen wie denen, mit denen wir in Bärenleben konfrontiert sind, aus dem Weg zu gehen. Entsprechend diesen Kriterien hat unsere Arbeitsgruppe sich näher mit den Zielgebieten Kanada, USA, Karpaten, Alpen und Pyrenäen befaßt.
Kanada ist zweifellos das menschenleerste Territorium, aber es gibt zunehmend ein Nahrungsproblem. Neben der üblichen pflanzlichen Kost, die aufgrund der kurzen Sommer recht beschränkt ist, muß man sich als Bär überwiegend von Lachsen ernähren,…““Igitt!“ murmelte jemand aus dem Hintergrund, „…aber aufgrund des menschlichen Raubbaus an der Natur haben die Lachse extrem abgenommen. Wir würden also in ein Hungerland ziehen.
In den Alpen und den Pyrenäen versuchen die Menschen gerade ein Wiederansiedelungsprogramm für Bären und auch Wölfe – eigentlich also ideale Bedingungen.
Leider aber sind diese Gebirge in der Mitte Europas zu dicht besiedelt. Es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Bauern, die sich nicht scheuen, ihr Gewehr zu gebrauchen. Deshalb können wir diesen Siedlungsraum nicht empfehlen.
Die Karpaten sind zwar recht menschenleer, es handelt sich bei ihnen aber um ein politisch instabiles Gebiet. Wir rechnen damit, daß es dort in Kürze zu kriegerischen Handlungen kommen wird.
Bleiben die USA. Dort sind Bären eine geschützte Spezies – in den Nationalparks, aber auch in anderen ausgewiesenen Gebieten. Das sind zwar begrenzte, aber zum Teil riesige Territorien – die gesamten Rocky Mountains zum Beispiel. Es gibt eine Fülle einzelner großer Gebirgsstöcke, an die 3000 Meter hoch und menschenleer, in denen Bären sich je nach Jahreszeit in unterschiedlicher Höhe aufhalten und ihre Bedürfnisse befriedigen können. Wenn man als Bär nicht gerade eine Mülltonne leert – was in Anbetracht der dortigen bärengeschützten Mülltonnen fast unmöglich ist – oder ein Touristenzelt aufschlitzt, ist man dort völlig sicher und satt. Wir empfehlen die USA!“
Die Versammlung bedankte sich mit lautem Grunzen und Brummen für die positive Nachricht. Nur Bärdel schwieg skeptisch – er erinnerte sich nochgut an seine USA-Reise (vgl. „Bärdel meetes Smokey the Bear“).
„Tja!“ sagte Tumu und nickte ihrer Freundin zu. Bei der aktuellen Arbeitsteilung hatten hauptsächlich die Frauen die Kopfarbeit übernommen, in der Hoffnung, daß die kräftigeren Männer hinreichend Nahrung herbeischaffen würden. Nur Kulle hatte sich dieser Arbeitsteilung verweigert, er war Mitglied der AG „mögliche Wege“. Aber Tumu legte wert darauf, daß sie diese Arbeitsgruppe leitete.
„Tja. Leider paßt unser Bericht nicht so recht zu dem, was wir eben gehört haben. Ihr könnt euch sicher denken, daß wir uns Wanderrouten
in die Alpen, die Pyrenäen und sogar die Karpaten überlegt haben. Realistische Routen, meiner Meinung nach, auf denen wir nicht entdeckt worden wären und genug zu fressen gefunden hätten. Aber da wollen wir ja nicht hin. Kanada, USA – für unsere Überlegungen waren beide Ziele gleichwertig. Zwischen uns und beiden Ländern liegt Wasser, viel Wasser,
so viel Wasser, daß wir es nicht durchschwimmen können. Wir brauchten ein Schiff oder ein Flugzeug, um dorthin zu kommen. Beides kostet Geld, und das haben wir nicht.“
Tumu holte tief Atem.
„Mir persönlich, und vielleicht auch vielen oder allen anderen, erscheint die Empfehlung, in die USA umzuziehen, plausibel. Aber ich weiß nicht, wie wir das bewerkstelligen sollten.“
„Es gab da mal einen Menschen namens Thor Heyerdahl, der ist noch gar nicht so lange tot. Der hat ein Floß aus Balsaholz gebaut und ist nach Westen gesegelt, um zu beweisen…“
Unwillig unterbrach Bärdel seinen Sohn.
„Ja, Heyerdahl wollte beweisen, daß eine Schiffspassage über den Atlantik mit bestimmten einfachen Mitteln zu bewältigen ist. Er wollte und er konnte nicht beweisen, daß eine solche Reise immer klappt. Das aber sollte uns wichtig sein – wir wollen schließlich alle ankommen. Deshalb ist die Methode Heyerdahl für uns indiskutabel.“
Manfred fühlte zwar die mentale Ohrfeige, gab aber nicht auf.
„Hijacking?“
„Death sentence?“ hackte Bärdel.
„Was heißt das denn?“
„Wenn man mit illegalen beziehungsweise äußerst fragwürdigen Methoden in die USA einreisen will, sollte man zumindest wissen, was ‚Todesstrafe‘ heißt,“ knurrte Bärdel.
„Schluß jetzt!“ mischte Tumu sich energisch ein. „Ein Familienkrach ist wohl das letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Aber Bärdel hat Recht, abenteuerliche, risikoreiche Methoden sind für uns garantiert ungeeignet.“ Nach einer Denkpause fuhr sie fort: „Wenn uns alleine keine Lösung einfällt, sollten wir überlegen, ob wir jemanden kennen, der uns vielleicht helfen kann!“
„Zum Beispiel dieser alte Kotzbrocken!“ schimpfte eine alte Bärin vor sich hin.
Zuerst wußte niemand, wen sie meinte. Aber dann kam die Erinnerung – die Alte hatte damals bis zur Erschöpfung gearbeitet, gekocht, gebacken, gefegt, ein luxuriöses Bett aufgeschlagen – alles umsonst.
Damals, als Grizzy Bärenleben besuchte (vgl. „Bärenbesuch“).
Grizzy, der Grizzly, der einen Plan zur Vernichtung der Menschen verfolgte und sich stoisch gab, der aber Tumus unbändigem Lebenswillen unterlag und seine Aktivitäten einstellte. Grizzy, der seit seinem Besuch bei ihnen verschwunden war, obwohl sie ihn eingeladen hatten, bei ihnen zu bleiben.
„Weiß eigentlich jemand, wo der Klugscheißer ist?“ brummte die Alte.
„Nein!“ sagten Kulle und Manfred im Chor.
Wenn jemand wissen könnte, wo sich Grizzy aufhielt, dann sie. Sie hatten genau recherchiert, aber Grizzy hatte keine Web-Adresse mehr, gab keine Interviews, nahm nicht mehr an internationalen Konferenzen teil.
Er schien wie vom Erdboden verschluckt. Nur Dina hatte eine Vision, sah kurz ein Bild vor Augen: Grizzy saß in der Abenddämmerung auf der Dritten Mesa und malte ein Sandbild. Mitten unter den Hopi war er nach Navajoart in hozro, in Einklang mit sich und der Natur.
Sie behielt die Erscheinung für sich – dieser meditierende Bär war wohl glücklich, aber keine Hilfe für Bärenleben.
Schweigen breitete sich aus. Wenn Hilflosigkeit einen Geruch hatte, dann war die Höhle erfüllt von ihrem Gestank.

Die Steckdosenschnauze zuckte aufgeregt, die wenigen Haare waren gesträubt, der Ringelschwanz hatte sich ganz eng zusammengezogen. Es konnte die resignative Stille nicht länger ertragen. Seiner Meinung nach
war es Zeit für ein bisschen Entspannung, vielleicht auch Hilfe.
„Wißt ihr, ich fühle mich wohl hier in Bärenleben, unter Bären. Ich will immer bei Euch bleiben!“
Die Aussage wurde mit vereinzeltem zustimmendem Gebrumm
kommentiert, das dem Schwein Mut machte. Bären lassen sich gerne schmeicheln.
„Ihr seid so – gemütlich. Viel gemütlicher als andere. Glaubt mir, ich kann das beurteilen. Ich kenne nämlich viele Tiere, hauptsächlich natürlich Schweine. Aber auch andere. In meiner Jugend war ich in einem Streichelzoo. Wißt Ihr,
was ein Streichelzoo ist?“
Die meisten Bären wußten es nicht und verlangten nach einer Erklärung. Das Schwein schien ein Märchen erzählen zu wollen, und sie ließen sich
nur zu gerne für eine Weile von den unangenehmen Problemen der Wirklichkeit ablenken. Nur Kulle runzelte ärgerlich die Stirn und öffnete schon den Mund, um zu unterbrechen, aber im letzten Moment fing er einen Blick von Bärdel auf und schloß ihn wieder.
„Ein Streichelzoo ist eine Abteilung in einem Zoo, in der viele verschiedene junge Tiere leben. Tagsüber werden die Tiere auf eine Wiese geschickt, und die Kinder der Menschen kommen, um die Tiere zu streicheln – oder das zu machen, was sie unter Streicheln verstehen. Dabei gibt es so manchen blauen Fleck!“
Die Bären knurrten zornig, aber das Schwein winkte ab.
„Wir wollen jetzt nicht schon wieder über Menschen reden – sie sind eben entweder dumm oder grausam!
Der Vorteil dieses Streichelzoos war, daß ich viele verschiedene Tiere kennenlernen konnte – Ziegen, Hasen, Hühner und sogar einen Gorilla!“

„Stimmt, der lebt eigentlich in Afrika. Aber die Menschen, die Zoos einrichten, nehmen auf so etwas keine Rücksicht. Jedenfalls, die Ziegen waren zickig und wollten mich immer auf die Hörner nehmen, die Hasen liefen ständig vor mir weg, und die Hühner hackten nach mir. Keiner war gemütlich, so wie ihr, auch nicht der Gorilla. Der wollte dauernd mit mir boxen. Trotzdem habe ich mich mit ihm angefreundet.
Wir haben neben den Boxkämpfen über meine Zukunft als Koteletts geredet, und er hat mir Gorillamärchen erzählt ((vgl. „Grimmis Buch vom Gorillasee“)).
Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der die Gorillas von den Menschen bedroht wurden. Alles sah so aus, als würden sie ausgerottet. Aber eine sagenhafte riesige Fröschin hat sie gerettet, die Menschen vernichtet und schließlich eine neue Welt geschaffen.“
Jetzt platzte Kulle endgültig der Kragen. „Welch ein Unsinn! Märchen, schön und gut! Aber die Welt ist wissenschaftlich beherrschbar, nur wissenschaftlich, das erzähle ich Euch seit Jahren! Riesige Fröschinnen, die eine neue Welt schaffen! Pah! Der flüchtige Rauch einer Zigarre
(vgl. „De rerum tabbaccorum“) ist realistischer als das! Schluß mit dem Unsinn! Laßt uns lieber überlegen, wie wir Geld besorgen – in der Welt der Derivate, der sogenannten Wertschöpfung aus dem Nichts, der Welt des Computerhandels und der Fakes dürfte das doch keine unüberwindliche
Schwierigkeit darstellen! Manfred kann bestimmt…“
Jeder Satz ein Ausrufezeichen, aber trotzdem wurde Kulle gebremst, und zwar ausgerechnet durch Manfred. Bärdel hatte schon tief Luft geholt, aber er brauchte gar nichts zu sagen.
„Moment mal!“ meinte Manfred nachdenklich.
„Ich kenne die Story, die das Schwein erzählt. Das muß ein alter Gorillamythos sein. Ich habe ihn im Internet gefunden, herausgegeben von einem würdigen Silberrücken namens Grimmi Gorilla. Ich glaube nicht, daß der alte Herr schwindelt. Wollt Ihr die Geschichte lesen?“
Natürlich wollten sie. Zwar war es inzwischen später Abend, und sie hatten nichts gegessen, aber kein Bär kann einer Geschichte widerstehen, schon gar nicht einer guten. Also installierte Manfred flugs seinen größten Monitor, lud die Geschichte, und dann lasen, sahen und hörten sie. Stundenlang,
bis helles Sonnenlicht in die Höhle sickerte.
Dennoch schien kein Bär müde zu sein, und auch das Schwein hielt seine Äuglein tapfer weit offen.
„Und das soll stimmen?“ fragte Tumu endlich skeptisch.
„Ob es stimmt oder nicht, kann uns egal sein,“ sagte Manfred. „Diese Tussi hat zur Lösung aller Probleme eine neue Welt geschaffen, eine Welt ohne Menschen, aber voll von Schlampanski – was immer das auch ist. Wir leben jedoch leider in einer Welt mit Menschen. Also lebt Tussi in einer anderen Dimension als wir, also kann sie uns nicht helfen.“
„Ach ja, Stinker?“
Direkt vor dem Monitor, den sie völlig verdeckte, saß plötzlich eine riesige Fröschin, deren Farben ständig zu wechseln schienen – bald hatte sie einen grünen Rücken mit gelbem Bauch, einen Moment später schien sie schwarz
und weiß gefleckt zu sein. Unverändert starr aber sah sie Manfred aus dreieckig geschlitzten Pupillen an.
Noch starrer als der Blick waren die Bären.
„Puh!“ sagte die Fröschin. „Ich bin von den Gorillas zwar einiges gewohnt, aber Ihr stinkt noch besser, das muß ich zugeben. Ich schick Euch demnächst mal einige meiner Kinder zur Darmreinigung vorbei, die können das hervorragend – habt ihr ja gerade gelesen. Im Übrigen seid Ihr ziemlich kleinkariert – glaubt Ihr ernsthaft, daß jemand, der den guten alten Christengott nach Strich und Faden fertigmacht, nur in einer Welt zu Hause ist?
Und Du“ – jetzt fixierte sie Kulle – „Dir will ich mal speziell was sagen. Die Antiquiertheit des Menschen – und auch des Bären, hihi – läßt eine rein rationale Erfassung der Welt nicht zu. Punktum. Abgesehen davon, daß ich meinerseits eine rein rationale Erfassung der Welt nicht zulassen will. Will, verstehst Du? Die Welt als Wille und Vorstellung… So, genug der Grundsatzerklärungen. Die Menschen haben Euch entdeckt, Ihr müßt hier weg. Ich helfe Euch. Wollt Ihr in die Neue Welt, oder wollt Ihr bloß einen Lift?“
Unter dem Worthagel krümmten sich die Bären zusammen. Kulle hatte sich zu einer vollkommenen Kugel gerollt, Bärdel streckte lediglich den Kopf hervor und kam sich dabei ungeheuer mutig vor, Manfred hielt die Augen geschlossen und tastete blind nach irgendeinem Knopf zum Ausschalten. Alte und junge Bärinnen und Bären bildeten im Hintergrund der Höhle
zwei schwer entwirrbare Knäuel. Nur Tumu und Dina wagten es, in die dreieckigen Pupillen zu blicken.
„Du bist…?“
„Tussi, wer sonst?“
„Du bist wirklich?“
Die riesige Fröschin wurde ungeduldig. „Wenn ihr wollt, könnt Ihr mich ja kneifen. Ich hab nicht ewig Zeit. Draußen, da, wo ich jetzt sein sollte, vergeht gerade eine Ewigkeit. Also beeilt Euch. Ich brauche eine Entscheidung. Neue oder alte Welt?“
Tumu tastete nach Dinas Hand und fühlte einen Druck.
Sie wußte nicht genau, was der bedeuten sollte, aber mit einer Sicherheit, die sie selbst überraschte, sagte sie: „Alte Welt.“
„Na gut!“ sagte Tussi. „Des Bären Wille ist sein Himmelreich. Wann soll ich Euch abholen? Ich schätze, zwei Wochen Zeit habt Ihr bestimmt.“
Tumu fragte nicht nach, was ‚abholen‘ hieß. Auch wollte sie kein Risiko eingehen.
„In drei Tagen,“ antwortete sie.
Allmählich erwachten die Bären aus ihrer Starre.
Die meisten kamen aber nicht zu Bewußtsein, sondern grunzten nur und verfielen sofort in den wohl verdienten Schlaf.
Am dritten Tag hatten alle ihre Habseligkeiten gepackt.
Als sie am Morgen aus der Höhle trotteten, betrachteten sie staunend das glänzende Tussimobil, das davor parkte.
Tussi saß hinter der Steuerkonsole.
„Where to?“ fragte sie und spielte mit den Hebeln.
„In die USA“, sagte Tumu und wagte sich entschlossen als erste in das unbekannte Gefährt. Zunächst zögernd, dann aber immer weniger zurückhaltend folgten ihr die anderen Bärenlebener. Bärdel vergewisserte sich, daß alle in dem glitzernden Ding verschwunden waren, und stieg als letzter ein. Innen war Tussis Gefährt viel geräumiger, als es von außen aussah – es bot Platz für eine gemütliche Höhle, neben der ein Bach
plätscherte. Alles, was Bärenmägen begehren konnten, wuchs in ungewohnter Fülle auf engem Raum. Selbst ein extra Eichelberg für das Schwein war liebevoll in einer Ecke aufgehäufelt worden.
Alle Bären brummten begeistert und machten es sich gemütlich, ohne der Angelegenheit auf den Grund gehen zu wollen. Manfred konnte seine Neugierde jedoch nicht bezähmen.
„Tussi“, sagte er, „entschuldige bitte, aber mir ist aufgefallen, daß dieses Ding hier innen viel größer ist als außen. Das widerspricht physikalischen Gesetzen. Du mußt wissen, daß ich mich sehr für Naturwissenschaften…“
Tussi sagte nur: „Später!“, ohne den Kopf zu wenden, während sie sich auf andere Probleme konzentrierte. „Hätte Dich beinahe weggedacht,
hihi! Wollte ich gar nicht. Habe jetzt aber keine Zeit für ABC-Schützen-Fragen. Was meint deine Mutter übrigens, wenn sie USA sagt? New Jack?“
Was oder wo, verflixt, war „New Jack“? Manfred hatte keine Ahnung.
„Ich denke, meine Mutter möchte dahin, wo wir Bären leben können“, sagte er schlicht.
„Na gut, New Jack lassen wir ausfallen, hihi. Rockies? Darauf spekuliert ihr wohl, was? Nee, machen wir auch nicht. Zu voll. Da leben schon zu viele andere Bären, nette Kerle übrigens, und abgesehen davon seid ihr für diese Gegend zu verweichlicht. Bei fünf Meter Schnee innerhalb von zwei Tagen kommt ihr doch vermutlich zu dem Schluß, der jüngste Tag sei gekommen, oder?“
Manfred mußte gegen seinen Willen nicken, und Tussi fuhr befriedigt fort.
„Sag ich doch. Wir lassen die Sache also ein bißchen niedriger angehen, und ein bißchen leerer. Ich dachte an Utah. Dünn besiedelter Staat mit hohem Bevölkerungswachstum, aber trotzdem genau das richtige für euch. Derzeit cirka 1,8 Millionen Menschen auf 212.000 Quadratkilometern, wenn Du’s genau wissen willst. Jede Menge Nationalparks, National Monuments,
Wilderness Areas, Primitive Areas, Wildlife Reserves.
Tendenz eher steigend. Alles so zwischen 700 und gut 3000 Metern hoch. Arides Klima: kalte Winter, heiße Sommer. Wasser ist manchmal ein Problem, aber nicht in den Bergen, und die Berge sind einsam. Einverstanden?“
Manfred sah sich um. Kein Bärenlebener kümmerte sich um ihn oder Tussi. Hinter seinem Rücken fand ein Festmahl statt, von dem er bisher nichts bemerkt hatte. Jetzt allerdings stiegen auch ihm verführerische Düfte in die Nase – heiße Brombeeren mit Honigsoße, der Vanille zugesetzt worden war, konnten jeden Bären um den Verstand bringen, beinahe auch ihn selbst. Aber er nahm sich zusammen.
„In Bärenleben treffen wir alle wichtigen Beschlüsse gemeinsam, das habe ich von meinem Vater gelernt!“
„Ich weiß!“ sagte Tussi. „Aber ihr seid nicht mehr und noch nicht wieder in Bärenleben. Du mußt jetzt entscheiden, du allein. Genau so allein, wie ich immer entscheide.“
„Einverstanden!“ Manfred wußte, daß er nichts entschieden, sondern sich einem vorgefaßten Entschluß Tussis gebeugt hatte. Er bemerkte, daß das Tussimobil das weiße Licht verließ, in dem es während ihrer Unterhaltung verharrt hatte. Blauer Himmel über vereinzelten weißen Wolken wurde sichtbar. Das Gefährt sank schnell tiefer, tauchte durch Kumuli und steuerte auf einen imposanten Gebirgsstock zu. Als es inmitten eines Birkenhaines
zum Stillstand kam, spürte Manfred keinen Bodenkontakt, aber er wußte, daß sie gelandet waren.
„Das sind übrigens keine Birken, sondern Aspen“, sagte Tussi, die mühelos seine Gedanken las. „Macht nichts – auf den ersten Blick ist manches hier genauso oder aber ganz anders als in Dehland. Das meiste ist ähnlich, das wirst du merken. Aber ihr wolltet es ja so haben. Keine New World, sondern nur einen Lift.“
Tussi öffnete die Luke – oder wie sonst nannte man die Türöffnung eines Tussimobils? – und hüpfte auf eine sattgrüne Waldwiese. Ihre Passagiere taten es ihr nach und purzelten in die neue Heimat, die meisten äußerst ungeschickt, weil sie sich überfressen hatten. Bärdel gab sich Mühe, gemessenen Schrittes auszusteigen, aber irgendwie verhedderte auch er sich und stolperte.
Tussi beobachtete das alles schmunzelnd.
„Okay, here we are. Die Sprache werdet ihr hoffentlich ohne mich lernen. Manches andere ist ein bißchen komplizierter. Er wird euch helfen. Ich lasse ihn da. Das meiste, was ihr braucht, kann er euch beibringen.“
Tussi griff sich an die Hüfte. Bärdel hatte den Eindruck, daß sie einen Reißverschluß an ihrem Körper aufzog, aber das konnte natürlich
nicht sein. Das Geräusch jedenfalls war ähnlich, und als es verklungen war, hockte ein ziemlich kleiner Frosch, der aus einer blauen Blase zu kommen schien, vor ihm und lächelte ihn schüchtern an. Abgesehen von einem gelben Bauch war er leuchtend grün.

Tussi und ihr Tussimobil waren verschwunden. Bärdel hatte es aufgegeben, sich über irgend etwas zu wundern. Er besah sich den kleinen Kerl genauer und begrüßte ihn zwar distanziert, aber mit freundlichem Brummen.
„Guten Tag“, sagte er.
„Guten Tag!“ antwortete der kleine Frosch.
Sein Lächeln wurde breiter. „Guten Tag! Ich heiße Ramses.“
Bevor Bärdel antworten konnte, spürte und hörte er hinter sich eine Bewegung. Etwas näherte sich, tastend, stolpernd, aber beharrlich. Anscheinend war einer von Tussis Passagieren aus seiner postgourmandisen Lethargie erwacht und schickte sich jetzt an, seine neue Heimat zu begrüßen. Oder sich zu übergeben. Bärdel wunderte sich über sich selbst. Sarkastische Gedanken waren sonst nicht seine Sache. Sie waren ein Zeichen dafür, daß er sich überfordert fühlte. Mit der rechten Tatze strich er sich – konsequent im Gegenuhrzeigersinn – über den Solarplexus und dachte dabei im Uhrzeigersinn an gar nichts. Das seit Urzeiten tradierte Bärenberuhigungsmittel half – als er sich nach der Quelle der Bewegung umsah, war er völlig entspannt und keineswegs überrascht, Kulle zu sehen.
„Ramses!“ Kulle war vollgefressen und aus dem Gleichgewicht geraten, deshalb klang seine Stimme heiser und schrill. „Ramses!“ Kulle wollte
kichern, produzierte aber nur ein ersticktes Kieksen.
„Ramses! Welcher denn?“ Kulle mußte husten und schluckte angestrengt, weil es ihm offenbar ein Bedürfnis war weiterzusprechen.
„Welcher denn? Ramses I., 1292 – 90 vuZ., Begründer der 19. Dynastie, General und Wesir des kinderlosen Horemheb? Oder Ramses II., manchmal genannt der Große, 1279 – 13, übrigens die zweitlängste Regierungszeit
ägyptischer Pharaos überhaupt? Falls du das bist, kannst du mir bestimmt einiges über deine Kriege gegen die Hethiter und Libyer erzählen – die Geschichtsbücher sind da sehr zürückhaltend. Vielleicht bist du aber auch Ramses III., der…“
„Schluß!“ sagte Bärdel. „Schluß.
Schluß. Schluß. Ich bezweifle nicht, und unser junger neuer Freund wird bald meiner Meinung sein, daß du uns auch noch etwas über die Ramsesse Nummer Vier-bis-ich-weiß-nicht-wieviel erzählen kannst, aber erstens wollen wir das in diesem Moment nicht wissen, und zweitens finde ich, daß jetzt nicht die Zeit für eine deiner ich-bin-ein-wissenschaftlich-gebildeter-Bär Einschüchterungsshows ist. Wir sind gerade auf einem uns unbekannten Kontinent gelandet und sollten uns vernünftiger benehmen als Kolumbus. Wie wäre es, wenn du das neue Mitglied unserer Gemeinschaft einfach mal ganz schlicht begrüßtest?“
Kulle schaute verwirrt drein, aber der Frosch blickte heiter in die Gegend. Er strahlte Kulle geradezu an.
„Ich bin Ramses“, sagte er. „Einfach nur Ramses. Und du mußt Kulle sein. Ich erkenne dich an der Fliege. Tussi hat mich vor dir gewarnt. Bestimmt hat sie Grund dazu, aber ich finde dich nett. Über diesen Horemheb zum Beispiel müssen wir noch mal ausführlich diskutieren – schließlich hat er den alten Kult der Naturgottheiten wieder eingeführt, und Frösche haben…“
„Schluuuusss!“ Bärdel spürte, wie die beruhigende Wirkung seiner Solarplexusmassage sich in Nichts auflöste. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, daß sich inzwischen ganz Bärenleben um Kulle und Ramses versammelt hatte. Die meisten hatten staunend den Mund geöffnet, denn sie wußten nicht, daß es neben Tussi noch einen Frosch gab, der sprechen konnte.
„Schluß!“ sagte er energisch zum fünften Mal. „Zumindest vorerst: Schluß. Über diesen Haremskerl könnt Ihr Euch später streiten. Jetzt ist Zeit für eine offizielle Vorstellung.“
Er trat zwei Schritte zurück. „Das ist Ramses, den Tussi uns dagelassen hat, um uns zu beraten, wenn wir Probleme haben. Ramses, wir danken Dir alle, daß Du zu uns gekommen bist!“
Die Bären klopften die Pfoten gegeneinander und brummten, das Schwein quiekte im Takt dazu genau eine Oktave höher, und Ramses gelber Bauch lief sanft rot an. „Danke!“ sagte er erkennbar verlegen.
„Ich hoffe, ich kann Euch helfen, wann immer es nötig ist!“
„Ich fürchte, Deine Hilfe habe ich gerade sehr nötig!“ japste das Schwein. Seit wir hier sind, habe ich das Gefühl, daß ich ersticke. Ist hier etwa die Luft vergiftet?“
Das Schwein war nicht allein mit seinem Problem. Auch viele Bären griffen sich an die Kehle oder an den Kopf und machten einen unglücklichen Eindruck.
Ramses schüttelte den Kopf. „Nein, die Luft ist hier bestimmt sauberer als da, wo ihr herkommt. Aber sie ist dünner. Wir sind hier ungefährt 9500 Fuß hoch.“
„Aber dann müssen wir alle ersticken!“
„Die Luft ist doch im Himalaya schon viel zu dünn!“
„Tussi will uns umbringen!“
„Hat jemand Sauerstoffmasken mitgebracht?“
Einige Bären kreischten hysterisch durcheinander. Andere ließen sich von ihrer Unruhe anstecken, und auch Bärdel und Kulle sahen sich verunsichert an. Tumu und Dina hielten einander fest an den Händen. Manfred dagegen war die Ruhe selbst. Als naturwissenschaftlich denkender Bär war er daran gewöhnt, auf die Einheiten zu achten.
Ramses war über die Reaktion, die er hervorgerufen hatte, sehr erschrocken und schien davonhüpfen zu wollen, aber Manfred hielt ihn fest und klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. „Keine Panik!“ sagte er. „Wir Bären sind nun mal Feuerköpfe,immer gleich aufgeregt, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Am besten ist es zu warten, bis alle sich beruhigt haben, und die Sache dann zu erklären.“
Ramses folgte seinem Rat und sah sich wenig später von skeptischen und fragenden Blicken durchbohrt. „Also“, sagte er und schluckte, „also, das sind doch 9500 Fuß! Fuß, nicht Meter! Ein Fuß entspricht gut 30 Zentimetern. Wir sind hier ungefähr 3000 Meter hoch. Daran werdet ihr euch schnell gewöhnen, auch wenn ihr jetzt erstmal Atemnot und Kopfschmerzen
habt. Vielleicht ist einigen auch übel. Aber in einer halben Stunde ist das vorbei.“ Er nickte bekräftigend und hüpfte genau 30,48 cm hoch
in die Luft, um seine Worte zu unterstreichen. In dieser Höhe blieb er länger, als er eigentlich vorgehabt hatte, denn das Luftpolster, das die erleichtert prustenden Bären unter ihm bildeten, trug ihn tatsächlich dreißigeinhalb Sekunden lang.
„Was ist das denn für eine bescheuerte Idee, in Füßen zu messen?“ Ein alter Bär, den seine Kopfschmerzen noch granteliger machten, als er ohnehin schon war, betrachtete skeptisch seine hinteren Extremitäten. „Mein Fuß ist ungefähr 21 cm lang, schätze ich, und der von meiner Frau 17. Alles krumme Zahlen, alles unterschiedliche Füße. Kann mir das mal jemand erklären?“
„Selbstverständlich!“ Kulle drängelte sich in den Vordergrund, rückte seine Fliege zurecht und schien vollkommen vergessen zu haben, daß er vor wenigen Sekunden noch unter starkem Schwindelgefühl gelitten hatte. „Selbstverständlich! Die Entwicklung der Maßeinheiten in der Geschichte des sogenannten Homo sapiens sapiens entspringt dem objektiven Bedürfnis von sozial lebenden und zumindest teilintelligenten Individuen, sich…“
„Kulle!“ Obwohl Bärdel nur flüsterte,hörte Kulle sofort auf zu sprechen. Diesen Ton kannte er: Bärdel stand kurz vor einer Eruption,wenn er ihn benutzte.
„Entschuldigung“, murmelte Kulle. „Ich wollte doch nur…“
„Ja, ich weiß“, sagte Bärdel müde und rieb sich seine schmerzende Stirn. „Aber überlaß das doch erst mal Ramses. Tussi hat ihn genau deswegen hier gelassen, denke ich.“
„Das metrische System, an das ihr von Europa her gewohnt seid und das heute fast überall auf der Welt gilt, ist noch nicht sehr alt. Bevor es entwickelt wurde, haben die Menschen alle möglichen Maße benutzt, auf die sie sich irgendwie geeinigt haben. Solche alten Maßeinheiten gelten noch hier in den USA und außerdem in Burma und Brunei. 1975 wollte man auch hier zum metrischen System übergehen, aber dann wurde ein konservativer Präsident namens Reagan gewählt, und der hat 1981 dafür gesorgt, daß alles beim alten blieb.“
Ramses sprach sachlich und bescheiden, und Kulle zog sich lautlos in den Hintergrund zurück. Bärdel hatte den Eindruck, daß sein Fell eine Schattierung dunkler war als gewöhnlich, aber er war sich nicht ganz sicher.
„Na schön“, meinte Tumu. „Ungewohnte Höhenlage, andere Maße und Gewichte – da habe ich uns ja was eingebrockt. Und das ist doch bestimmt
noch nicht alles, oder?“
„Bestimmt nicht!“ Ramses schmunzelte. „Manches ist sicher viel schöner, als ihr es gewohnt seid.
Schaut euch doch nur mal um!“
Erst jetzt bemerkten die Neuankömmlinge, daß noch keiner von ihnen auf die Idee gekommen war, die weitere Umgebung in Augenschein zu nehmen. Die Wiese, auf der sie standen, wurde von Laubbäumen mit hellen Stämmen – „Aspen“, erklärte Ramses – und Tannen und Fichten begrenzt. Von ihrem Standort aus waren drei hohe Gipfel erkennbar, kahle, graue steinige Kegel, auf denen noch Schneereste lagen. Der Himmel darüber war makellos blau, die Kumuli darin ebenso makellos weiß. An einer Seite öffnete sich der Blick in die Ebene, die weißlich und rötlich in der Hitze flimmerte.
Tumu suchte Bärdels Hand und fand sie. Staunend stand sie da, und auch die anderen blinzelten überwältigt in die Landschaft. Selbst Kulle war beeindruckt von all der Schönheit, die sie umgab, und merkte, daß ihm Tränen in die Augen treten wollte. Sentimentalität, fand er, paßte aber ganz und gar nicht zu einem wissenschaftlich denkenden Bären.
„Der Bär definiert sich durch Arbeit“, brummte er deshalb und wandte sich Ramses zu. „Du hast doch bestimmt schon eine Höhle für uns
entdeckt, oder? Also, Bärinnen und Bären, Schwein und Frosch: Fegen, Betten bauen, Beeren etc. sammeln! Statt Gutenachtgeschichte veranstalte ich heute Abend einen Einführungskurs: Basic Facts above the USA.“
„Eine gute Idee!“ lobte Ramses. „Vor allem der Einführungskurs: Basic Facts about the USA. Kommt, ich zeige euch die Höhle!“
Erst auf dem Weg zur Höhle merkte Kulle, daß Ramses ihn korrigiert hatte, aber er ließ sich seine gute Laune dadurch ebensowenig verderben wie alle anderen. Niemand hatte mehr Kopfschmerzen. Alle freuten sich auf ein neues Leben. Nur das Schwein runzelte noch einmal kurz die Stirn.
„Sag mal, Ramses, wie heißt die Gegend hier eigentlich?“
„Ihr seid in den La Sal Mountains, und das hier ist eure Höhle. Herzlich willkommen!“
Kulles Kanzler-Interview
Kulles Kanzler-Interview

Guten Morgen, Herr Kanzler. Haben Sie gut geschlafen?
Kanzler:
Danke, ausgezeichnet.
Kulle:
Das wundert mich. Denn die Gewinneinkommen sind in den vergangenen sechs Jahren um netto 44 Prozent gestiegen, und die Einkommen aus abhängiger Beschäftigung netto um 3 Prozent. Der hohen Staatsverschuldung auf der einen Seite steht eine ungeheure Anhäufung der privaten Geldvermögen gegenüber. 30 Prozent des Geldvermögens waren 1996 auf drei Prozent der privaten Haushalte konzentriert. Und das läßt einen sozialdemokratischen Kanzler ruhig schlafen? „Kulles Kanzler-Interview“ weiterlesen
Krieg
„Jetzt reicht’s aber wirklich!“ sagte Tumu empört nach dem Ende der „Tagesschau“. Nein, nicht ganz nach dem Ende: Weder die Sportnachrichten noch den Wetterbericht wartete sie ab. Das war seltsam: Zwar interessierte sie sich überhaupt nicht für die sogenannten fairen Wettbewerbe der Menschen, aber dem Wetter der nächsten Tage widmete sie üblicherweise ihre volle Aufmerksamkeit, schätzte die witterungsbedingt zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel ein und stellte dementsprechend ihren Speiseplan zusammen.
Bärdel schüttelte zwar sanft tadelnd den Kopf, blieb aber ruhig sitzen und wunderte sich auch nicht, als er in der Nacht auf seinem Lager alleine blieb. Er hatte es aufgegeben, sich über Frauen allgemein und Tumu speziell zu wundern – am besten war es, wenn man ihnen ihre Launen ließ und sich nicht darüber aufregte.
Als Tumu am Morgen wieder auftauchte, machte er aber doch große Augen. Ihre dagegen waren ganz klein. Sie sah aus wie eine Bärenfrau, die die ganze Nacht lang nicht geschlafen hat. Wortlos drückte sie Bärdel ein sorgfältig gefaltetes großes weißes Tuch in die Pranken.
Manfred geht zur Schule
„Aua!“
Bärdel wischte sich die Pfote an der Hinterbacke ab, ohne nachzudenken. Von der Biene, die ihn gestochen hatte, blieb nur ein Brei aus Chitin und undefinierbaren Flüssigkeiten übrig. Er sah sich um.
Im Apfelbaum hinter ihm summte ein Bienenschwarm von mindestens einem Meter Durchmesser, der sich zusehends verkleinerte. Sie ließen sich nieder, drängten sich eng an eng um ihre Königin, um sie zu beschützen. Ein neuer Schwarm, ein Schwarm ohne Stock. In dieser Phase waren die Bienen immer aggressiv. Bärdel verstand jetzt, warum ihn eine gestochen hatte.
„Manfred!“
Manfred, der die Imkerei des Bärenstammes übernommen hatte, reagierte nicht. Er hatte ein paar leere Bienenkörbe eingelagert, um auf Situationen wie diese vorbereitet zu sein. Er wäre jetzt nützlich gewesen. Aber statt seiner tauchte Tumu auf.
„Manfred ist nicht da,“ erklärte sie schlicht.
„Immer dasselbe,“ brummte Bärdel. „Wir hätten jetzt gut eine neue Bienenheimat für einen neuen Stamm und dafür einen mutigen Imker gebrauchen können. Aber Manfred ist ja nie da, wenn es nötig ist. Wo ist er denn?“
„In der Schule,“ sagte Tumu, als sei das das selbstverständlichste von der Welt.
Bärdel runzelte die Stirn. Plötzlich tat seine Hand von dem Insektenstich wieder weh. Aber die Ursache war nicht die Biene, das wußte er genau.
„In welcher Schule?“ wollte er wissen.
„Es gibt nur eine Schule, das weißt Du so gut wie ich.“
„Die Menschenschule? Und Du bist damit einverstanden?“
„Ja. Er hat es sich gewünscht. Kulle findet das übrigens auch gut.“
„Kulle?“
„Kulle. Er muß es schließlich wissen, er hat seine Erfahrungen gemacht.“ (vergleiche: „Die Lehre“))
„Und wenn er entdeckt wird?“
„Er wird nicht entdeckt, das weißt Du genau. Schließlich hat er es schon einmal geschafft, sich als Mensch auszugeben. (vergleiche: „Jobsuche)„) Und Du hat doch auch schon unter menschlicher Maske agiert, nicht wahr?“ (vergleiche: „Menschenliebe„)
„Na ja“, brummte Bärdel. „Schön und gut, aber wer bändigt jetzt die Bienen?“
„Ich natürlich!“ sagte Tumu. „Schließlich habe ich Manfred die Imkerei beigebracht.“
In der Tat hatte Manfred zunächst keinerlei Probleme. Er trabte nach Lehrte – den Weg kannte er schließlich gut – und fand in der kleinen Stadt schnell das Gymnasium. Im Sekretariat zog er ein gut gefälschtes Zeugnis über den erweiterten Sekundarabschluß I aus der Tasche – übrigens auch mit guten Noten versehen. Er wurde freundlichst begrüßt, vom Direktor, der gerade, wie die meisten Gymnasialdirektoren, nichts zu tun hatte, zum Kaffee eingeladen, er füllte ein Anmeldeformular aus, und schon war „Manfred Bär“ Schüler der Klasse 11 B.
Manfred war noch in der Dunkelheit in Bärenleben aufgebrochen, aber der Anmarsch und die Formalitäten hatten Zeit gekostet. Es war jetzt später Vormittag. Er stand wieder auf dem Gang vor dem Sekretariat, als ein mißtönender Gong erschallte. Er begann mit einem harmonischen absteigenden Dreiklang – ding – deng – dong -, endete aber auf einer unpassenden Septime. Manfred fragte einen jungen Mann, der ihm entgegenkam, was das zu bedeuten habe.
„Eh, Alter, biste doof, eh? Das war der Gong nach der beschissenen dritten Stunde. In fünf Minuten kannste das Gleiche noch mal hören – dann klingelt’s zur noch viel beschisseneren vierten Stunde. Die wird ich übrigens abhängen und n Köfte einpfeifen – kein Bock auf Physik!“
Manfred hatte Mühe, den nuschelnden Typen zu verstehen. Das mochte am Kaugummi liegen, den er unentwegt zwischen seinen Zähnen zu zermalmen versuchte. Er hatte aber auch das Gefühl, daß zahlreiche Laute im Schirm der Baseballkappe hängen blieben, die der Junge tief in die Stirn gezogen hatte. Vielleicht verschwanden sie aber auch in seinem Hosenboden, der, für Manfred unverständlich, irgendwo zwischen den Kniekehlen hing.
Er verzichtete auf irgendwelche Nachfragen und wollte nur noch wissen: „Kannste mir sagen, wo die 11 B ist?“
Was zeigt, daß Manfred schnell lernt.
„Zweiter, letzte Tür. Gehörste dazu? Viel Spaß – die haben jetzt Geschichte.“

„Zehn fehlen!“ stellte sie schließlich fest. Dann endlich entdeckte sie Manfred. „Und wer sind Sie?“
„Manfred Bär. Ich gehör jetzt dazu, kannste glauben.“
Manfred war sehr stolz darauf, daß er den Slang, den man hier offenbar sprach, so schnell gelernt hatte. Aber er mußte etwas falsch gemacht haben, denn das Gesicht der Lehrerin verzog sich ärgerlich.
„Wenn Sie sich weiterhin dieses Jargons bedienen, werden Sie bestimmt nicht lange dazugehören, das können Sie mir glauben! Setzen Sie sich!“
Manfred suchte sich einen freien Platz neben einer jungen Frau, die sofort demonstrativ ein Stück zur Seite rückte. Von seinem Hintermann hörte er ein leises „Cool!“ Er hatte keine Ahnung, worauf sich dieser Kommentar bezog und was er bedeutete. Kühl war es in diesem Klassenraum nicht gerade.
Der Ärger der Lehrerin war anscheinend noch nicht verraucht, denn sie nahm sich Manfred gleich noch einmal vor.
„Wir beschäftigen uns in dieser Phase des Unterrichts mit der griechischen Antike. Manfred, was wissen Sie darüber?“
Ach du liebe Tussi! Wie würde das wirken, wenn er jetzt erzählte, was er wußte? Er wußte nämlich eine Menge.
„Könnten Sie Ihre Frage bitte präzisieren?“
Immerhin, er hatte begriffen, daß er mit der Lehrerin eine andere Sprache sprechen mußte als mit seinen Mitschülern.
Die Klasse prustete los, und die Lehrerin wandte sich von ihm ab und der Klasse zu. Ihr Gesicht war jetzt zornrot.
„Danke, das reicht! Kann uns vielleicht sonst jemand helfen?“
Die Heiterkeit verschwand. Plötzlich hatte jeder Schüler etwas zu tun: suchte etwas in seiner Tasche, putzte sich die Nase, schrieb „Griechische Antike“ oben auf ein Blatt Papier oder schaute einfach nur auf die Tischplatte vor sich. Das Signal war eindeutig: Im Augenblick bin ich viel zu beschäftigt, um angesprochen zu werden.
Allmählich verstand Manfred. Niemand wußte etwas von der griechischen Antike. Die Lehrerin schien das gewußt zu haben, denn sie hatte seine Bitte um Präzisierung offenbar als Provokation verstanden. Aber warum hatte sie ihre Frage gestellt, wenn sie gar nicht mit einer Antwort rechnete? Merkwürdig! Aber er war ein Bär, und Bären sind nicht nachtragend. Manfred tat die Frau leid, wie sie so verloren vor der Klasse stand, die sie zu ignorieren versuchte. Er war bereit, ihr zu helfen.
Zaghaft hob er den Arm.
„Ja, Manfred?“
Trotz des drohenden Untertones in ihrer Stimme, der ihm rätselhaft blieb, legte Manfred tapfer los.
„In der griechischen Antike sind aus heutiger Perspektive vor allem die Aspekte Politik, Philosophie und teilweise auch Mathematik und Physik von Interesse. In den Poleis – Singular Polis – , in den Stadtstaaten also, finden wir mit Modifikationen bereits alle auch heute denkbaren Regierungsformen: Erbmonarchien, Diktaturen und Ansätze von Demokratie. Die griechischen Philosophen legten den Grundstein für Überlegungen, auf die bis heute noch keine allgemein anerkannten Antworten gefunden worden sind. Vom Solipsismus bis zum Materialismus ist dort alles vertreten.“
Manfred unterbrach sich selbst. Es war völlig still im Raum geworden. Nur durch die dünne Wand hörte man aus dem Nebenraum die dröhnende Stimme eines Mannes, der eine mathematische Formel zu erklären versuchte. Sowohl die Lehrerin als auch seine Mitschüler sahen ihn mit weit aufgerissenen Augen und zum Teil offenen Mündern an.
„Soll ich das näher erläutern?“ fragte er unsicher.
„Nein, danke.“ Die Lehrerin fing sich wieder und schenkte ihm ein anerkennendes Nicken. Sie griff in ihre Tasche und förderte einen Stapel Fotokopien zutage. „Sie haben mir ein Stichwort gegeben: Philosophie. Ich habe Ihnen einige wichtige Aussagen griechischer Philosophen zusammengestellt.“
Sie begann ihre Blätter auszuteilen.
Manfred las. Ganz oben stand der Satz: ‚Der Mensch ist das Maß aller Dinge.‘ (Protagoras)
„Das hätte ich mir denken können“, schoß es ihm durch den Kopf.
Was er sich nicht gedacht hatte, war, daß er die nächste Pause, die eine Viertelstunde dauerte, allein verbrachte. Zumindest fast allein. Er schien Luft für seine Mitschüler zu sein. Nur einmal rempelte ihn ein Junge unsanft an und sagte dabei:
Ey Du Arsch, wennde glaubst, dassde hier die Preise verderben kannst, denn kriegste ziemlichen Ärger, das versprech ich Dir. Bei uns is easy going angesagt, capito?“
Nein, Manfred kapierte nicht. Wie sollte ein kleiner Bär auch verstehen, daß Menschenkinder in einem Gymnasium ihre Energie hauptsächlich darauf verschwendeten, möglichst wenig zu lernen?
In der fünften Stunde stand Politik auf dem Lehrplan. Pünktlich mit dem Gong saß Manfred auf seinem Platz. Er blieb lange allein. Erst eine Weile später bummelten seine Mitschüler in den Raum, und der Lehrer, ein kleiner rundlicher Mann, der wohl ungefähr fünfzig Jahre alt sein mochte, erschien gemessenen Schrittes als letzter. Er seufzte – wohl anstelle einer Begrüßung -, ließ sich umständlich auf den Stuhl hinter dem Lehrerpult sacken, schaute freundlich in die Runde und fragte: „Was gibt es neues?“
„Anna hat’n neuen Freund!“ sagte ein Junge in der letzten Reihe.
„Sei ruhig, Du Arsch, was geht’n Dich das an!“ Das blonde Mädchen, das das sagte, war rot geworden. Vermutlich, dachte Manfred, war sie Anna.
„Interessant, interessant. Natürlich geht Paul das konkret sehr wenig an, es sei denn, er war Ihr voriger Freund, Anna. Aber uns alle, Sie alle geht das Problem an, das hier angesprochen worden ist: Wie finden junge Menschen in ihrem Alter den richtigen Partner beziehungsweise die richtige Partnerin? Ich halte es für eine gute Idee, heute darüber zu sprechen.“ Das war der Lehrer.
Die Klasse war nicht abgeneigt; es entwickelte sich sogar ein Gespräch, in dem vor allem die Jungen sich darin hervortaten, möglichst viel Gossenjargon zu produzieren. Manfred schwieg, denn er konnte als Bär zu diesem Problem wenig sagen, und lernte viel. Auch der Lehrer sagte kaum etwas, aber er war durchaus bei der Sache. Manfred erkannte das an seinen Augen, die dann zu glänzen begannen, wenn ein Schüler besonders konkret von seinen Erfahrungen berichtete. Das war ein guter Lehrer, fand er – anders als seine Kollegin in der Stunde zuvor verstand er es, seine Schüler zu motivieren.
Die Zeit bis zum Gong verging wie im Flug. Nachdem der Lehrer etwas in das große Heft auf dem Pult geschrieben hatte, verließ er das Zimmer. Erst jetzt merkte Manfred, daß er noch nicht einmal eine Tasche bei sich trug. Er ging zum Lehrertisch und betrachtete die neuesten Eintragungen. Erst jetzt erinnerte er sich, daß sie soeben Politik gehabt hatten. Hätten haben sollen. Neben die Fächerbezeichnung hatte der Lehrer geschrieben: Einführung des Euro. Aha.
Manfred fühlte sich ein wenig taumelig. Nicht nur die Schüler wollten nicht lernen, auch die Lehrer wollten also nicht lehren. Das hatte er sich alles ganz anders vorgestellt. Sollte er gleich wieder nach Bärenleben laufen oder noch die letzte, die sechste Stunde mitmachen? Morgen würde er bestimmt nicht mehr wiederkommen, soviel stand fest. Er beschloß zu bleiben, nachdem er einen Blick auf den Stundenplan geworfen hatte. ‚Biologie‘ stand dort. Das ging ihn als Bären einiges an.
Die alte weißhaarige Dame machte tatsächlich Biologieunterricht. Sie schaffte es sogar, einige Schüler mit ihrer Begeisterung anzustecken. Die Klasse mikroskopierte Pflanzenzellen, und die Schüler versuchten, das, was sie sahen, in einer Zeichnung festzuhalten. Die Lehrerin korrigierte die Ergebnisse freundlich, nannte die Namen der einzelnen Zellbestandteile – was die Klasse zum Stöhnen brachte – und erklärte dann, wie ein solches winziges Kraftwerk funktionierte. Sie sprach von Bewunderung für dieses Ergebnis der Evolution, das alle menschliche Technik weit in den Schatten stellte, ja sogar von Ehrfurcht.
Eine Biene hatte sich in den Fachraum verirrt. Sie schien das weiße Haar der Lehrerin mit einer Blüte zu verwechseln und steuerte darauf zu. Die Biologin gestattete ihr nur zwei Versuche, dann traf sie das Insekt gezielt mit dem dicken Lehrbuch, das sie in der Hand hielt. Zufrieden betrachtete sie ihr Zerstörungswerk und machte schon wieder den Mund auf, um weiter von der Faszination des Lebens zu schwärmen. In diesem Moment erklang der mißtönende Gong.
Zusammen mit den anderen verließ Manfred fluchtartig den Raum und machte sich auf den Weg nach Bärenleben. Unterwegs versuchte er, seine Eindrücke zu sortieren, aber alles wirbelte kunterbunt in seinem Kopf herum. Zu Hause schüttelte er als Reaktion auf Bärdels, Kulles und Tumus Fragen nach seinen Erlebnissen nur den Kopf und machte sich daran, einen unbehausten Bienenschwarm einzufangen – den zweiten des Tages. Allmählich wurde er dabei ruhiger, aber es dauerte noch Tage, bis er in der Lage war, der abendlichen Bärenversammlung alles zu erzählen. Nur mit Kulles Unterstützung glaubten ihm die anderen, daß er die Wahrheit sagte. Hätte Kulle nicht immer wieder versichert, daß er ähnliches erlebt hatte, die Dorfgemeinschaft hätte Manfreds Erzählung als Bärenmärchen abgetan.
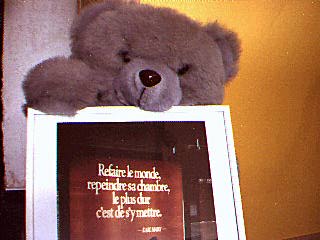
IWF


Kulle störte ihn in seinen genießerischen Überlegungen. Hoch erhobenen Hauptes stolzierte er durch die Gegend, ohne auf Weg und Steg zu achten. Er war vollauf damit beschäftigt, mal die eine, mal die andere Pranke zu heben, an das rechte oder linke Band seiner Fliege zu greifen und sich an den Kopf zu schlagen. Bei dieser merkwürdigen Beschäftigung stolperte er über Bärdel und fiel hin.
„Aua!“ sagte Bärdel. Kulle war auf seine Nieren gepurzelt.
„Was soll denn das?“
Bärdel setzte sich auf, und auch Kulle kam wieder auf die Füße.
„Entschuldige bitte. Ich war in Gedanken.“ Geistesabwesend zupfte Kulle schon wieder an seiner Fliege herum.
Bärdel schmunzelte. Eigentlich war die Sache mit Kulle ganz einfach: Wenn er eine Idee hatte, war er nicht davon abzubringen, und er verriet sie auch nicht, bis er meinte, daß er sie fertig entwickelt hatte. Wollte man vorher etwas aus ihm herausbringen, mußte man ihn ablenken, zumindest für eine Weile.
Bärdel klaubte zwei rotbackige Falläpfel auf, bot Kulle einen an und fragte dann:
„Lecker, nicht?“
Kulle biß in seinen Apfel, kaute und ließ von seiner Fliege ab. Bärdel wußte, daß er gewonnen hatte.
„Was brütest du denn aus?“ wollte er wissen.
Kulle schluckte süßen Apfelsaft hinunter, schlug in gut gespielter Bescheidenheit die Augen nieder und sagte:
„Ich habe ein neues Gesellschaftsspiel entwickelt.“
„Oh Gott!“ entfuhr es Bärdel. Er erinnerte sich gut an ‚Markt und Sozialstaat‚. Dieses sogenannte Spiel hatte Bärenleben beinahe zerstört. Er konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen als eine Neuauflage.
„Das verbiete ich!“ sagte er energisch. „Vergiß es. Erfinde stattdessen die ganz allgemeine Relativitätstheorie oder sonstwas – aber ich will kein neues gefährliches Gesellschaftsspiel in Bärenleben.“
„Es wird nicht gefährlich werden,“ antwortete Kulle. „Jedenfalls hoffe ich das. Diesmal sind nicht wir die Spieler. Ich habe ein Brettspiel gebastelt, mit ganz normalen Holzkegeln und vielen Ereigniskarten.“
„Und worum geht es dabei?“ erkundigte sich Bärdel.
„Um den IWF.“
„Was ist denn das für eine bescheuerte Idee?“ Manchmal war auch Bärdel nicht charmant.
„Das ist gar keine bescheuerte Idee. Wer hat denn darauf bestanden, daß wir die ‚Neue Zürcher Zeitung‘ abonnieren? Du! Seit alle Bären dieses Blättchen lesen, werde ich täglich mit Fragen bombardiert, die sich auf die Wirtschaft beziehen. Und seit der sogenannten Asienkrise habe ich überhaupt keine Ruhe mehr. Alle wollen von mir wissen, was da passiert ist und was der Internationale Währungsfonds dabei für eine Rolle spielt.“
Auch Kulle klang jetzt recht ungehalten.
„Und warum erklärst du es ihnen nicht?“
„Das habe ich ja versucht. Immer und immer wieder. Aber sie kapieren es nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, wir spielen das Ganze einfach.“
Bärdel biß ein zweites Mal in seinen Apfel.
„Gut“, sagte er nachdenklich. „Wahrscheinlich ist das eine gute Idee. Wenn ich’s mir genau überlege, kann ich diese wirtschaftlichen Zusammenhänge auch nicht erklären. Und was man nicht erklären kann, hat man nicht verstanden. Spielen wir also dein Spiel. Aber erst nach dem Abendessen. Was hältst du von ein paar Kartoffeln als Hauptgang und einer kleinen Honigwabe zum Schluß?“
Kulle hielt viel davon.
Nach Einbruch der Dunkelheit versammelte sich ganz Bärenleben in der großen Höhle. Aber dunkel war es dort nicht – schon seit einiger Zeit hatte Manfred

Kulle war ziemlich aufgeregt. Er war zwar daran gewöhnt, vor großem Publikum zu sprechen, aber er hatte noch keine Gelegenheit gehabt, das Spiel, das er sich ausgedacht hatte, wirklich zu erproben. Dennoch gab er sich gelassen.
„Bären,“ sagte er, „willkommen zum schönsten Teil des Tages. Laßt uns etwas spielen. Ich habe ein Spiel gebastelt, dem Leben nachempfunden, aber ich weiß nicht, ob es klappen wird. Aber auch im Leben gelingt längst nicht immer alles, wie wir wissen. Habt ihr Lust?“
Ich habe ein Spiel gebastelt, dem Leben nachempfunden, aber ich weiß nicht, ob es klappen wird. Aber auch im Leben gelingt längst nicht immer alles, wie wir wissen. Habt ihr Lust?“
Ein Brummen, so tief, daß es eher im Zwerchfell als in den Ohren klang, erfüllte den Raum. Oh ja sie hatten Lust.
„Gut,“ sagte Kulle. „Ein kleines Problem gibt es noch. Nicht alle von euch werden bei diesem Spiel gewinnen können. Deshalb werden wir die Spieler auslosen. Seid ihr einverstanden?“
Die Bären bekundeten Zustimmung, und Kulle holte daraufhin etliche klein gefaltete Zettelchen aus einer Nische und ließ jeden Bären einen auswählen. Dabei ermahnte er sie, keinem anderen zu verraten, welche Rolle er übernommen habe. Das werde sich erst im Spiel zeigen.
Als Kulle sah, daß jeder versorgt war, zog er drei Spielbretter aus seiner Geheimnische.
„Das Spiel ist ein bißchen kompliziert“, sagte er, während er die drei Papptafeln in drei Ecken der Höhle verteilte. Dabei justierte er jedes Spielbrett sorgfältig, bis es hörbar einrastete.
„Aber für alle gelten die gleichen Regeln: Würfeln und vorwärts ziehen. Wer auf ein Ereignisfeld gerät, muß eine Ereigniskarte nehmen und sich an deren Anweisungen halten. Jeder von euch hat auf dem Zettel, den er gezogen hat, zwei Informationen. Der erste Begriff sagt ihm, wer er ist und was er will oder tut, und der zweite, zu welcher Gruppe er gehört. Die Gruppenbegriffe sind ‚klein‘, ‚groß‘ und ‚Multi‘. Die ‚klein‘-Gruppe geht bitte an dieses Spielfeld, die ‚groß‘-Gruppe an das da hinten und die ‚Multi‘-Gruppe an das dritte.“
Dabei deutete er in die entsprechenden Richtungen. Es entstand eine kurze Unruhe, danach hockten die Bären in drei Gruppen zusammen.
„Jetzt könnt ihr anfangen“, sagte Kulle. “ Ihr könnt auswürfeln, wer den Anfang macht, oder es bleiben lassen. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wer beginnt.“
„Alle drei Gruppen spielen gleichzeitig?“ fragte ein alter Bär, der in seinem Leben nie etwas anderes als ‚Bär-ärgere-dich-nicht‘ gespielt hatte.
„Natürlich. Alle drei Gruppen spielen gleichzeitig. Das ist ja das Spannende an der Sache.“
Der alte Bär war in der ‚Multi‘-Gruppe gelandet. Ohne die anderen zu fragen, griff er sich den Würfel und ließ ihn rollen. Er zeigte eine Drei. Er zog daraufhin seine Spielfigur gehorsam auf ein Ereignisfeld und nahm die oberste Karte. Er las und grinste.
„Du mußt laut vorlesen, was auf deiner Karte steht“, sagte Kulle.
„Wir alle wollen jederzeit wissen, was der andere macht, und warum er es macht. In der Wirklichkeit ist das weniger transparent, aber wir wollen die Wirklichkeit ja transparent machen.“
„Ich bin Eigentümer der Nippon United Bank und gewähre der Suharto Sons Kautschukproduktion AG sechs Milliarden $ Kredit“, las der alte Bär gehorsam vor, wobei seine Lesegeschwindigkeit und sein Tonfall deutlich verrieten, daß er überhaupt nichts verstand.
Nicht nur er begriff nichts, auch alle anderen – außer Kulle natürlich – waren deutlich überfordert. Das Würfeln dieser einen Drei, das Ziehen dieser bestimmten Karte schien Auswirkungen auf das gesamte Spiel zu haben. Ohne irgendwelches bärische Zutun drehten sich die Spielfelder, veränderten zum Teil ihre Farbe, und die Karten auf den Ereignisstapeln mischten sich neu.
Ein Murmeln erhob sich.
„Was ist hier los?“ fragte Tumu. Als ordentliche Bärin hielt sie natürlich viel von Frauenzauber, aber dieses merkwürdige Schauspiel jagte ihr Angst ein.
„Keine Angst, Mama!“ Das war Manfred.
„Ich habe nur Kulles neues Spiel ein bißchen verbessert. Er will bestimmte Mechanismen zeigen, die multikausal sind. Also habe ich der Technik Dialektik beigebracht. Veränderte Parameter erzeugen veränderte Reaktionsmuster.“
„Gut, du hast also ein Programm geschrieben“, sagte Tumu. „Und soweit ich informiert bin, haben Menschen ein so adaptives Programm noch nicht zustande gebracht. Glückwunsch, mein Sohn. Aber warum sollen wir noch spielen, wenn sich alles selbst generiert?“
„Das Programm hat keinen Zufallsgenerator, Mama.Es paßt sich lediglich den neuen Gegebenheiten an. Wir Bären bestimmen, welcher Zug als nächster folgt. Deshalb ist es immer noch ein Spiel, auch wenn wir seine Regeln nicht festlegen können.“
„Ich hasse das“, murmelte Tumu vor sich hin. „Bildet der Kleine sich etwa ein, die Antinomie von Voluntarismus und Determinismus mit Hilfe intelligenter Software zu lösen?“ Aber sie entschloß sich, jetzt und hier auf eine grundsätzliche Diskussion zu verzichten. „Ich hab’s verstanden!“ sagte sie laut. „Das klingt spannend. Spielen wir weiter.“
„Wer spielt als Nächster?“ wollte das Schwein wissen, das als erster und einziger politischer Asylant in Bärenleben natürlich Ehrengast der Runde war.
„Wer will“, sagte Kulle. „Es können auch mehrere gleichzeitig ziehen. Ihr müßt euch nur darauf gefaßt machen, daß das Spiel lebendig wird: Vielleicht ist der eine oder andere Zug nicht möglich, weil gerade jemand anders gewürfelt hat.“
„Ich begreife das noch nicht“, beklagte sich eine junge Bärin. „Laßt uns bitte langsam spielen, nicht gleichzeitig, und jeder erklärt so viel wie möglich von dem, was das Spiel mit ihm macht. Schließlich hat Kulle doch gesagt, daß es bei diesem Spiel darum geht, etwas zu verstehen, und nicht darum, zu gewinnen, oder?“
Brummende Zustimmung.
„Alle scheinen einverstanden zu sein“, stellte Tumu fest. „Dann mach du doch weiter!“
Dadurch ermutigt, würfelte die junge Frau. Sie gehörte zur Gruppe der ‚Großen‘. Ihre fünf Augen führten sie auf ein Ereignisfeld.
„Die Suharto Sons AG baut eine neue Kautschukplantage und rodet dafür 1000 Hektar Regenwald. Auf den neuen Besitz nimmt sie eine Hypothek auf und finanziert davon den Bau einer Fabrik für Fahrrad- und Autoreifen.“
„Gerecht soll es zugehen!“ forderte ein Bär aus der Gruppe der ‚Kleinen‘. „Jetzt sind wir dran!“
Er würfelte und erwischte ebenfalls ein Ereignisfeld.
„Ich bin Muhamad Argoto, Bauer auf Sumatra. Ich habe fünf Söhne – vier zuviel. Mehr als eine Familie kann von meinem Land nicht leben. Der Familienrat hat beschlossen, daß meine vier jüngeren Söhne mit ihren Frauen und Kindern nach Jakarta ziehen werden. Sie werden dort eine Arbeit finden – es gibt jetzt viele neue Fabriken. Sie werden gut leben können, anders als hier.“
Der Bär wollte seine Ereigniskarte an der dafür vorgesehenen Stelle ablegen, zuckte aber erschreckt zurück. Das Spiel machte sich selbständig. Hunderte, vielleicht sogar tausende Kärtchen wieselten auf die Markierung zu, die seiner Karte zukam, und stapelten sich dort brav zu einem sauberen Häufchen.
„Was ist denn jetzt los?“ fragte er und zerknautschte seine eigene Karte vor Aufregung in seiner Pranke.
„Du bist eben nicht allein auf der Welt“, schmunzelte Kulle. „Gerade du nicht. Probier es doch einmal aus! Zieh ein paar Karten aus dem Stapel und lies sie uns vor!“
Das Ziehen klappte zwar nicht, weil der Bär warf den hohen Stapel ungeschickt umwarf, aber um so besser konnte er in dem Kartenhaufen wühlen.
„Ich habe sechs Söhne … meine Frau ist gestorben … man hat mir mein Land mit Gewalt genommen …“
Der Bär verstummte, aber er las noch eine Weile still weiter.
„Du hast recht“, sagte er dann. „Es ist irgendwie immer dasselbe. Alle können auf dem Land nicht mehr leben und ziehen in die Stadt.“ Er schüttelte den Kopf. „Ich wußte nicht, daß es so viele sind.“
„In der Wirklichkeit sind es viel mehr. Wir spielen hier nämlich nur.“
Kulle hatte sich die Bemerkung nicht verkneifen können, aber er merkte – hier lief etwas schief. Eine Tragödie schon nach drei Spielzügen, das war zu früh. Natürlich sollten die Bären etwas begreifen, aber erst am Ende, nicht schon am Anfang eines geselligen Abends.
Also griff er selber zu den Würfeln, natürlich am Spielfeld der ‚Multis‘ – etwas anderes zu sein als ein Global Player war unter seiner Würde, fand er.
Laut las er seine Ereigniskarte vor: „Ich bin ein Vertreter der Santander Investment Group. Die Suharto Daughters Ltd. erhält fünf Milliarden $ Kredit für den Aufbau einer nationalen Autoproduktion. Es handelt sich bei dieser Summe um die erste Tranche.“
Ebensowenig wie der alte Bär vor ihm konnte Kulle seine Karte ungehindert zurücklegen. Auch ihm flogen Karten zu, allerdings deutlich weniger. Er las sie auszugsweise vor: „Kredit für Suharto Nephews … für Suharto Aunts … für Suharto Oncles …“ Und immer handelte es sich um stolze Summen.
Jetzt wurde am Brett der ‚Kleinen‘ gespielt.
„Meine Eltern sind Bauern, ich habe noch sieben Schwestern. Ich werde in die Stadt ziehen und mir dort Arbeit suchen. Ich werde ganz bestimmt einen Job finden: Im Haushalt oder in einer Fabrik. Vielleicht werde ich mich auch selbst verkaufen, ich bin nämlich hübsch. Von dem Geld, das ich verdiene, werde ich so viel wie möglich meiner Familie schicken, damit sie besser leben kann als bisher.“
Auch hier sagten die Karten, daß die Spielerin mit ihrer Absicht keineswegs alleine war.
„Ich bin Zahnarzt in Dehland. Ich gebe zu, daß ich nicht schlecht verdiene. Natürlich nur in unserem kleinen Kreise. In der Öffentlichkeit würde ich das selbstverständlich nie sagen. Also: Ich verdiene gut, und deshalb habe ich das Problem, wie ich mein Vermögen möglichst gewinnbringend anlegen kann. Meine Bank hat mir zu einem gemischten südostasiatischen Aktienpaket geraten, mit Schwerpunkt Indonesien. Bevor ich gekauft habe, habe ich mich natürlich informiert – schließlich bin ich kein Glücksspieler! Die dortigen Unternehmen gelten international als völlig kreditwürdig, es gibt einen riesigen nationalen und internationalen Markt, und billige Arbeitskräfte garantieren hohe Gewinnspannen. Da gibt es nichts zu zögern – ich kaufe!“
Das kam von Grizzy, der am Mitteltisch gelandet war.
„Moment mal!“
Eine alte Bärin stand auf und brummte ärgerlich.
„Darfst du hier überhaupt mitspielen? Ich meine, natürlich darfst du mitspielen. Aber du hast doch eine falsche Rolle! Was hat auf einmal ein Zahnarzt aus Dehland hier zu suchen?“
Grizzy hatte Mühe mit der Antwort, weil er zunächst einmal vollauf damit beschäftigt war, die Karten zu ordnen, die ihm in großer Zahl zuflogen. Nachdem er einen ansehnlichen Stapel aufgetürmt hatte, sagte er:
„Ich verstehe zwar auch noch nicht genau, was das soll, aber dieser Kartenhaufen scheint mir recht zu geben. Wenn so viele Menschen etwas ähnliches machen wie ich, muß ich hier am richtigen Ort sein. Paß auf, ich lese dir mal einige Karten vor.
Hier: Besitzer einer Autowerkstatt, Ohio, USA. Hat für seine Altersvorsorge ostasiatische Aktien gekauft. Der nächste: Manager in Japan. Hat sein Vermögen umorganisiert und einen Teil seiner japanischen Aktien in indonesische umgewandelt. Spanien – leitender Angestellter einer Ölgesellschaft. Kauft indonesische Aktien, weil er sich lukrative Gewinne verspricht. Reicht das?“
Die Alte nickte langsam.
„Das reicht“, sagte sie. „Aber…“
Sie verstummte und dachte ziemlich lange nach, während die anderen geduldig warteten. Bären haben Respekt vor dem Alter und lassen den Alten die Zeit, die sie brauchen.
„Aber das heißt ja, daß dieses Spiel auf der ganzen Welt spielt?“ fragte sie schließlich unsicher.
Bedächtig nickten viele Bärenköpfe und ein Schweinekopf. Ja, das hieß es anscheinend.
Kulle kicherte lautlos in sich hinein und strich sich über die Fliege. Das erste Lernziel war erreicht.
So leicht war die Bärin aber nicht zufriedenzustellen.
„Das verstehe ich nicht“, murrte sie. „Wie können sich die Menschen überall auf der Welt so schnell miteinander verständigen?“
Manfred öffnete den Mund, aber bevor er etwas sagen konnte, kam Bärdel ihm zuvor. Er wußte, daß sein Sohn jetzt liebend gerne einen Vortrag über moderne Kommunikationstechnik abgespult hätte, den kaum jemand verstehen und der das Spiel stören würde.
„Es funktioniert einfach“, sagte er freundlich. „Wenn es dich interessiert, kann ich dir das bei Gelegenheit genauer erklären. Aber nicht jetzt. Laßt uns weiterspielen!“
Um Widerworten vorzubeugen, nahm er selbst den Würfel und ließ ihn rollen. Eine Sechs. Er setzte. Zum ersten Mal geriet ein Spieler nicht auf ein Ereignisfeld. Bärdel zuckte die Schultern und gab den Würfel weiter.
Dem nächsten Bären ging es genauso. Auch dem dritten. Keiner der nächsten zwanzig Spieler kam auf ein Ereignisfeld.
Unfreundliches Brummen erhob sich hier und da:
„Das Spiel wird langweilig!“
„Wieso passiert denn nichts?“
„Ich weiß gar nicht, was ihr wollt“, bemerkte Kulle betont unschuldig. „Es passiert eine Menge. Dreht euch doch mal um!“
Er zeigte zu einer Höhlenwand, und die Spieler folgten seiner Aufforderung. An der Wand hing plötzlich eine elektronische Anzeigetafel, auf der sich in schwindelerregender Geschwindigkeit Zahlen bewegten.
„Davon kriege ich Kopfschmerzen“, grumpfte der alte Bär, der das Spiel begonnen hatte, ungehalten. „Was ist das überhaupt?“
„Solche Tafeln hängen überall in der Welt an Plätzen, an denen Aktien gekauft und verkauft werden. Sie zeigen die Preise der Aktien und deren Entwicklung. Diese Preise nennen die Menschen Kurse. Sehen wir uns doch mal die Kurse von Suharto Daughters Ltd. an. Der Name der Firma steht ganz links. Daneben seht ihr den Preis, den der Käufer für eine Aktie bezahlt hat. Das ist in unserem Spiel jetzt einige Züge her. Und ganz rechts steht, was man heute für dieselbe Aktie bezahlen müßte, wenn man sie kaufen wollte.“
Aufmerksam folgten die Augen der Versammelten den Anweisungen. Tumu entdeckte den Trick als erste.
„Das kann doch nicht sein! Der Kurs der Aktie dieser Firma hat sich verzehnfacht!“
„Das kann schon sein, und das passiert auch“, erklärte Kulle. „Wenn viele Menschen eine begrenzte Menge von Aktien kaufen wollen, steigt deren Preis. Das funktioniert nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Der Wert der Firma spielt dabei aber merkwürdigerweise nur eine geringe Rolle. Erhöht sich der Wert der Firma – also ihr Kapital, ihr Gewinn – entsprechend, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, spricht man von einer spekulativen Seifenblase. Mit Devisen funktioniert das übrigens genauso. Die Kursentwicklung der indonesischen Rupiah ist in der untersten Spalte dargestellt.“
„Moment mal!“ Jetzt mischte Tumu sich ein.
„Du willst uns doch nicht erzählen, daß die Menschen so blöd sind, einen hohen Preis für etwas zu bezahlen, dessen Wert sie nicht kennen?“
„Doch, genau das versuche ich euch zu erzählen. Menschen wie der Zahnarzt aus Dehland, der Kfz-Meister aus Ohio oder der Manager in Japan wissen mit großer Wahrscheinlichkeit nichts von Suharto Daughters Ltd. Sie hoffen nur, daß sie die Aktien dieser Firma irgendwann – in zwei Monaten oder in zwanzig Jahren – mit Gewinn verkaufen können.“
„Und wie lange geht so etwas gut?“ wollte das Schwein wissen.
„Sehen wir nach!“ schlug Kulle vor. „Spielen wir weiter!“
Manfred brachte den Würfel wieder zum Rollen und erwischte, wie er es sich gewünscht hatte, ein Ereignisfeld. Weil er wußte, wer in diesem Spiel und im Leben der Menschen wirklich die Karten mischte, hatte er sich in die Multi-Gruppe gemogelt.
„Ich bin der Vertreter eines amerikanischen Bankenkonsortiums. Der Name spielt keine Rolle – wir möchten anonym bleiben. Aus zuverlässiger Quelle haben wir erfahren, daß die Suharto-Firmen in Indonesien unseriöse Geschäfte betreiben. Kurzfristig vergebene Kredite wurden langfristig angelegt, und zwar in Geschäftsfeldern, deren Profitabilität äußerst fragwürdig ist. Wir können allen Investoren nur raten, ihre Gelder zurückzuziehen.“
Die Reaktion des Spiels verblüffte den alten Bären – alias Nippon United Bank – und beinahe auch Kulle als Repräsentanten der Santander Investment Group. Ihre Ereigniskarten, die sie beide festhielten, flutschten ihnen aus den Pfoten und flogen Manfred zu. Dazu erhielt er Grizzys Karten und noch etliche andere, die bisher ruhig in den Stapeln auf den Spielfeldern geruht hatten.
Ärgerlich brummte der alte Bär: „He, was soll das? Das ist meine Karte, die will ich behalten!“
Er stand auf und näherte sich Manfred bedrohlich.
„Gib sofort meine Karte wieder her! Die habe ich ehrlich erspielt!“
Prügel lag in der Luft.
Also doch, dachte Bärdel resigniert. Kulles Spiele sind einfach zu gefährlich.
Aber Kulle rettete die Situation.
„Du kannst deine Karte selbstverständlich gerne wiederhaben“, erklärte er freundlich. „Aber bevor du das tust, solltest du erstmal auf die Anzeigentafel schauen!“
Der Alte verstand zwar nichts, war aber immerhin für den Augenblick abgelenkt. Nicht nur er gehorchte Kulles Rat, auch alle anderen richteten ihre Augen auf das Display.
Kulle half ihnen: „Die rechte Spalte!“
In der rechten Spalte war der Teufel los. Die Flüssigkristallanzeige veränderte sich so schnell, daß es kaum möglich war, ihr zu folgen. Eines aber war doch zu erkennen: Die aktuellen Kurse waren in freiem Fall.
„Na und?“ fragte der alte Bär. „Was hat das mit meiner Karte zu tun?“
„Deine Karte sagt, daß du Geld verleihst. Dieses Display zeigt, daß deine Schuldner immer weniger Geld haben. Wenn du dein Geld zurückhaben willst, mußt du deine Karte abgeben, also deinen Kredit zurückziehen. Deshalb ist dir die Karte weggeflogen. Das Spiel hat das für dich gemacht.“
Manchmal konnte Kulle sogar geduldig sein. Aber den Alten hatte er trotzdem nicht überzeugt.
„Was schert mich Geld!“ grollte er. „Menschenkram! Ich will meine Karte!“
Tumu sah, daß Kulle tief Luft holte, und griff ein. Sie hockte sich neben den Alten und kraulte ihm beruhigend den Nacken.
„Du hast ja recht“, brummte sie. „Aber wir spielen hier ein Menschenspiel. Wir wollen die Menschen verstehen. Mach einfach mit!“
Der Alte beruhigte sich, und Kulle ließ die Luft aus seinen Lungen. Es konnte weitergehen.
Es ging anders weiter, als die Bären gedacht hatten. Zu ihrer Überraschung machte sich jetzt der Würfel selbständig und flog der jungen Bärin in die Hand. Gleichzeitig segelte eine Ereigniskarte auf sie zu.
Die junge Frau fischte die Karte aus der Luft und las sie vor. Die Botschaft war kurz.
„Die Suharto Sons AG meldet Konkurs an.“
Würfel und Karten wanderten selbständig weiter.
„Hier ist wieder Muhamad Argoto. Meine vier Söhne sind aus Jakarta zurückgekommen – sie haben ihre Arbeitsplätze verloren. Ihre Fabrik ist geschlossen. Sie haben ihre Familien mitgebracht. Ich weiß nicht, wovon wir alle in Zukunft leben sollen.“
Der Bär, der durch Zufall in die Rolle eines indonesischen Kleinbauern geraten war, hielt sich schützend die Pranken vor die Augen. So viele Karten schossen auf ihn zu, daß er sich regelrecht bedroht fühlte.
Seiner Nachbarin erging es nicht besser, Würfel und Karte drängten sich ihr auf.
„Ich bin entlassen worden. Zuerst ging alles nach Wunsch: Ich habe eine Zeitlang auf der Straße angeschafft, dann einen Job als Kindermädchen gefunden, und zuletzt habe ich in einem sweat-shop als Näherin gearbeitet. Das Übliche: zwölf Stunden Arbeit am Tag , Akkord, und niedriger Lohn. Meiner Familie konnte ich trotzdem ein bißchen Geld schicken. Sogar gespart habe ich für mich. Aber jetzt ist es aussichtslos, weiter in der Stadt zu leben: Arbeit werde ich nicht mehr finden, und die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Ich werde wieder nach Hause gehen, aber wie wir da überleben sollen, weiß ich einfach nicht.“
Die Karten flogen und schienen sie unter sich zu begraben.
„Das ist ja fürchterlich!“ murmelte ein spontaner Bärinnenchor. Alle Frauengesichter wandten sich Kulle zu.
„Und jetzt?“ fragten sie, immer noch unisono.
„Jetzt“, erklärte Kulle feierlich, „kommt der Deus ex machina.“
Die Energiesparlampen flackerten und erloschen danach. In der nun völlig dunklen Höhle rumpelte es. Der Boden erzitterte ein wenig. Die Bären atmeten hastig und schnauften unruhig. Aber sie bewahrten Disziplin. Jetzt hörten sie das Geräusch von Metall auf Metall, begleitet von einem leichten Quietschen. Schließlich rastete irgend etwas ein. Etwa einen Meter über dem Boden leuchtete ein durchsichtiger Quader auf, in dem sich aus dem Nichts ein Kopf materialisierte.
Die Bären reagierten mit irritiertem Brummen und Grunzen, das Schwein mit einem erschreckten Quieken. Das zornigste Geräusch stammte eindeutig von dem alten Bären. Er hielt den unbekannten Kopf für einen Eindringling, der vertrieben werden mußte. Zum Glück saß Tumu noch neben ihm, und es gelang ihr zum zweiten Mal, ihn zu beruhigen.
Als der Kopf den Mund öffnete und zu sprechen begann, breitete sich atemlose Stille aus.
„Guten Abend, meine Damen und Herren Bären“, sagte er. „Oh, ich sehe, ich habe jemanden vergessen. Das ist ja noch ein Schwein. Sind Sie Herr Schwein oder Frau Schwein? Ich will nicht indiskret sein, aber ich würde auch Sie gerne korrekt begrüßen.“

„Dann also Herr Schwein“, beschloß der Kopf. „Wenn Sie eine Frau sein sollten, dann wissen Sie ja aus Erfahrung, daß sich bei der männlichen Anrede die Frauen immer mitgemeint fühlen dürfen. Also guten Abend, Herr Schwein.“
Das Schwein war so perplex, daß es tatsächlich „Guten Abend“ sagte, anstatt dem Kopf eine ordentliche Ohrfeige zu verabreichen.
„Gestatten Sie, daß ich mich vorstelle“, fuhr der Kopf fort. „Mein Name ist Camdessus. Michel Camdessus. Ich bin der Direktor des IMF. Oh Verzeihung, in Dehland sagt man wohl IWF.“
„Des was?“ Das war Tumu.
Kulle öffnete den Mund uns wollte zu einem seiner zwar amüsanten und belehrenden, aber in der Regel endlosen Vorträge ansetzen, jedoch zupfte Grizzy rechtzeitig an seiner Fliege. Kulle schloß die Lippen wieder und ärgerte sich über sich selbst. Schließlich hatte er höchstpersönlich dafür gesorgt, daß die Menschen in diesem Spiel sich weitgehend selbst erklärten, aber sein professoraler Belehrungsdrang war wieder einmal beinahe mit ihm durchgegangen.
Michel Camdessus verdrehte in gespieltem Schmerz die Augen.
„Es ist wohl das Schicksal meiner Organisation, daß kaum jemand sie kennt. Dabei bewirken wir so viel Gutes. Aber häufig tun wir das in der Tat im Verborgenen. ‚IWF‘ heißt ‚Internationaler Währungsfonds‘, und ‚IMF‘ ist lediglich die englische Variante des Begriffs: ‚International Monetary Fond‘. . Diese Organisation gibt es seit 1945. Wir haben im Laufe der Geschichte unterschiedliche Ziele verfolgt, das muß ich, denke ich, hier nicht im einzelnen entwickeln. Heute bestehen unsere Aufgaben darin, Entwicklungsländern aus wirtschaftlichen Krisen zu helfen. Also zum Beispiel aktuell Indonesien.“
Das klang gut, fanden die Bären, und sie schlugen die Tatzen ineinander und klatschten Beifall. Auch das Schwein schloß sich an. Am begeistertsten applaudierte die Bärin, die im Spiel als junge Frau in die Stadt gezogen war und jetzt zu ihrer armen Familie auf dem Land zurückkehren mußte. Sie hatte sich mit ihrer Rolle identifiziert.
Sie wagte es, den Kopf im leuchtenden Quader anzusprechen.
„Ich danke Ihnen, Monsieur Camdessus. Wissen Sie, wer ich bin, oder soll ich das kurz erklären?“
Der Kopf bewegte sich von links nach rechts und wieder zurück.
„Das ist nicht nötig. Ich weiß, wer Sie sind.“
„Wie werden Sie mir helfen, Monsieur Camdessus?“
„Junge Frau, das ist nicht so einfach zu erklären. Es handelt sich hier um höchst komplizierte multilaterale finanzielle Zusammenhänge. Vermutlich werden Sie von den Kausalitäten überfordert sein. Können Sie lesen und schreiben?“
Kaum spürbar hatte sich ein Unterton in die Rede des Kopfes eingeschlichen, der Verachtung zeigte. Die sensiblen Bären merkten das und reagierten mit leichter Unruhe.
Auch der Bärin war die atmosphärische Veränderung nicht entgangen. Sie beschloß aber, ohne Aggressionen weiterzuspielen. Selbstverständlich konnte sie lesen und schreiben, in ihrer Freizeit beschäftigte sie sich mit Kant und Hegel, was sie sehr spannend fand, aber getreu ihrer Rolle sagte sie: „Nein.“
„Sehen Sie“, antwortete der Kopf befriedigt, als sei Analphabetismus sein persönlicher Erfolg. Er schaute in die Runde und registrierte, daß alle Augenpaare ihn aufmerksam anschauten. Man schien etwas von ihm zu erwarten.
„Nun gut“, seufzte der Kopf. „Ich werde es versuchen.“ Ihr Land Indonesien ist in eine schwere Wirtschaftskrise geraten. Ihre florierende Wirtschaft hat sich nicht hauptsächlich auf Eigenmittel, sondern auf internationale Kredite gestützt. Allerdings haben Ihre Wirtschaftsunternehmen die Kredite häufig nicht so verwendet, wie es mit den Gläubigern abgesprochen war. Als das bekannt wurde, haben die Gläubiger ihre Kredite zurückgezogen. Den Unternehmen Indonesiens fehlt dementsprechend jetzt Kapital, es gibt Unternehmensschließungen zuhauf, und Arbeiter werden arbeitslos. Damit verbunden ist ein Verfall der nationalen Währung. Soweit klar?“
Die Bären nickten ungeduldig. Das wußten sie schließlich alles schon. Nur der alte Bär schaute den Kopf staunend an: Ihm war jetzt erst alles verständlich geworden.
„Alles klar“, sagte die Bärin, der ihre Rolle als Dialogpartnerin allmählich Spaß zu machen schien. „Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Monsieur Camdessus: Wie werden Sie mir helfen?“
„Der IWF hat die Lage Indonesiens geprüft und beschlossen, Ihrem Land Kredite zu gewähren. Sie werden bald wieder Geld haben, denn Sie bekommen – auf etliche Tranchen verteilt – an die 60 Milliarden Dollar.“
Die Bärin staunte. „Moment mal – Indonesien hat ungefähr 200 Millionen Einwohner, das habe ich im Lexikon gelesen.“
Als der Kopf zweifelnd die Augenbrauen runzelte, verbesserte sie sich rasch: „Nur ein kleiner Scherz. Ein kluger Bär hat mir das erzählt. Der hat mir übrigens auch ein bißchen Rechnen beigebracht. Wenn 200 Millionen Indonesier 60 Milliarden Dollar bekommen, dann kriege ich also ungefähr 300 Dollar. Und jedes meiner Familienmitglieder auch. Ich habe eine große Familie, wissen Sie! Das ist wirklich mehr als Hilfe!“
Der Kopf schüttelte sich irritiert.
„Wieso Sie und Ihre Familie?“ fragte er. „Das ist ein Mißverständnis. Natürlich werden die Kredite nicht flächendeckend verteilt, sondern gezielt eingesetzt und auch nur unter bestimmten Auflagen vergeben. Erstens verlangen wir eine Abwertung Ihrer Rupiah, um die Inflation einzudämmen. Im Moment liegt die Inflationsrate in Ihrem Land bei über 40 %. Außerdem ist Ihr Land hoch verschuldet. Damit das Loch im Staatshaushalt gestopft werden kann, fordern wir eine Senkung der Staatsquote. Erst wenn das gewährleistet ist, werden die Gelder fließen, gezielt eingesetzt und nicht nach dem Gießkannenprinzip. Die Leistung Ihres Bruttoinlandsprodukts ist in den letzten drei Monaten um über acht Prozent gesunken. Notwendig ist also eine gezielte Wirtschaftsförderung.“
Jetzt war die Bärin tatsächlich ein wenig überfordert. Sie wußte viel über das Ding an sich, den kategorischen Imperativ und den Weltgeist, aber Ökonomie war nicht gerade ihr Spezialgebiet.
„Schade“, sagte sie deshalb nur und blickte verstohlen hilfesuchend in die Runde, in der Hoffnung, daß der Kopf das nicht bemerken würde.
Grizzy sprang ein.
„Das ist ja wirklich ziemlich kompliziert“, erklärte er und lächelte freundlich. „Deshalb möchte ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie gestatten.“
Der Kopf nickte großzügig.
„Wenn wir unsere Währung abwerten, dann bedeutet das, daß alle Waren, die wir aus dem Ausland beziehen müssen, teurer werden, nicht wahr?“
Nicken.
„Also werden sich die Menschen noch weniger kaufen können als bisher, und die Armen werden überhaupt nicht mehr zurechtkommen!“
Der Kopf wiegte sich zweifelnd und versuchte ein leichtes Schütteln.
„Sie fordern eine Senkung der Staatsquote. Das bedeutet, daß der Staat weniger Geld ausgeben soll. Wofür gibt ein Staat Geld aus? Neben so sinnlosen Sachen wie der Rüstung …“ – bei diesen Worten schüttelte der Kopf sich wahrhaft angeekelt – „…hauptsächlich für seine Bürger: Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung, Straßenbau und so weiter. Mit anderen Worten: Eine Senkung der Staatsquote bedeutet eine drastische Verschlechterung der Lebensverhältnisse vor allem der ärmeren Bevölkerung!“
Allmählich begriffen die Bären und rückten dem Kopf näher. Der aber lächelte überlegen.
„Herr Bär…“
„Grizzy“, sagte Grizzy.
„Herr Grizzy, verzeihen Sie, aber das ist doch alles Propaganda, was Sie da von sich geben. Sehen Sie, der Mensch ist frei. Ich bin der letzte, der sich gegen Chancengerechtigkeit ausspricht. Staatliche Übervorsorge aber zerstört dieses Prinzip. Wo ist noch Chancengerechtigkeit, wenn ein arbeitsscheuer Zeitgenosse geruhsam auf Kosten eines fleißigen Steuerzahlers leben darf? Ist es gerecht, wenn Besserverdienende indirekt Zahlungen für ein staatliches Schulsystem leisten, in dem nicht leistungsbereite, aggressive Kinder von asozialen Eltern entweder durch Absentismus glänzen oder ihre Lehrer tätlich angreifen? Jeder ist seines Glückes Schmied – und wer will, kann sich privat gegen persönliche Lebensrisiken absichern.“
Die Bären rückten ein weiteres Stück näher. Grizzy aber nickte nur leichthin.
„Dann habe ich noch eine letzte Frage. Sie sprachen von gezielter Wirtschaftsförderung. Wie sieht das konkret aus?“
Der Kopf lächelte selbstgefällig. „Wir haben da bewährte Rezepte. Natürlich müssen wir mit den Wirtschaftsunternehmen arbeiten, die existieren. Wir beraten sie und wirken darauf hin, daß sie ihr Management effektiver gestalten. Das heißt also Rationalisierung, Qutsourcing, lean Production – falls Ihnen das etwas sagt.“
Einige Bären guckten irritiert, aber Grizzy sagte das sehr viel.
„Mit anderen Worten: Sie wollen mit mehr Maschinen schneller produzieren, also Personal entlassen, und unprofitable Betriebsteile machen Sie zu sogenannten Tochterfirmen, in denen die Beschäftigten unter deutlich schlechteren Bedingungen und dazu mit niedrigeren Löhnen arbeiten als in der Stammfirma.“
Der Kopf wand sich.
„So können Sie das nicht sagen…“
„Ich kann schon, das haben Sie ja gerade gehört“, fuhr Grizzy ihm in die Parade. „Und ich habe recht.“
Der Bärenkreis war jetzt ganz eng und sehr unruhig. Als erstes verlor das Schwein seine Beherrschung.
„Du Schwein!“ quiekte es. Es hatte sich wirklich völlig vergessen. Dennoch gelang es ihm, sich elegant auf einen Hinterhuf zu stellen und den leuchtenden Quader mit dem Kopf zu attackieren. Es fand aber keinen Widerstand. Die umsitzenden Bären sahen einen Schweinekopf, auf dem sich Teile des Gesichts von Michel Camdessus abzeichneten. Verwirrt hielt das Schwein inne.
Manfred löste das Rätsel.
„Das ist nur ein Hologramm“, erklärte er. „Eine dreidimensionale Projektion. Die kann man nicht verletzen. Aber alles, was das Ding eben gesagt hat, ist echt. Ich habe alle Aussagen von Camdessus, die ich kriegen konnte, gesammelt. Und dann brauchte ich nur noch ein kleines Programm, das die Aussagen, die auf eure Fragen paßten, ausgewählt hat. Ich schalte den Kerl jetzt besser aus.“
Der Quader erlosch, die Lampen gingen an. Die Bären blinzelten und schauten einander an.
„Und jetzt?“ fragte die Bärin, die immer noch nicht von ihrer Rolle losgekommen zu sein schien.
„Jetzt ist es spät, und wir gehen ins Bett“, entschied Bärdel. „Vorher aber sollten wir uns noch bei Kulle und Manfred bedanken. Ich denke, daß wir mit ihrer Hilfe viel über die Wirtschaft der Menschen gelernt haben.“
Die Bären bekundeten Zustimmung. Der Alte erhob sich als erster.
„Das war ein schönes Spiel!“ grunzte er und rammte Kulle seine Pranke auf die Schulter. Der kleine Bär knickte beinahe zusammen, fand aber auch, daß das das schönste Lob war, daß er einheimsen konnte.
„Gute Nacht!“ gähnte das Schwein. „Und wenn ihr mich fragt: Die spinnen, die Menschen!“
Niemand erhob Widerspruch.
War, Sex and Crime
Manfred war in seiner Technikbegeisterung nicht zu stoppen – monatelang war er in den umliegenden Menschensiedlungen nachts unterwegs, durchstöberte Müll und Sperrmüll und sammelte das, was die Menschen für Schrott hielten. Er lagerte das Zeug in seiner Privathöhle und verbarrikadierte sich irgendwann für etliche Tage darin, so daß Tumu ihn nicht zu Gesicht bekam, obwohl sie ihn mit den leckersten Honigkuchen zu locken versuchte. Als Manfred schließlich wieder auftauchte, war er immer noch nicht ansprechbar. Stattdessen turnte er durch ganz Bärenleben und installierte Kabel, Lautsprecher und Monitore. Schließlich ertönte ein ohrenbetäubender unartikulierter Lärm, der alle Bären aufgeregt aus ihren Höhlen trieb. Manfred aber winkte seinen Artgenossen spielerisch und ironisch zu.
„Ich habe fertig!“ erklärte er. „Bärenleben hat jetzt seinen lokalen Fernsehfunk!“
Auf den Monitoren flimmerte elektronischer Schnee.
Die meisten wandten sich kopfschüttelnd ab. Fernsehen in einem winzigen Bärendorf, lokales Fernsehen – was sollte das denn? Und dann diese Sprache – woher hatte Manfred bloß diese fehlerhafte Grammatik? Bärdel schüttelte ebenfalls den Kopf. Tumu schüttelte den Kopf, und während sie es tat, rief sie: „Komm essen!“ Aber Manfred achtete nicht auf sie, sondern bastelte weiter an seinen Installationen.
Der einzige, der nicht seinen Kopf schüttelte, war Kulle. Nicht, daß sein Kopf in Ruhe geblieben wäre. Aber er schüttelte ihn nicht, er wiegte ihn leise hin und her. Er witterte eine Chance, und er wog das damit verbundene Risiko ab.
„Manfred“, sagte er, so sanft er konnte, und er konnte sehr sanft sprechen, „Manfred, hättest Du etwas dagegen, wenn ich für unseren neuen lokalen Fernsehfunk einen Programmbeitrag leiste? Einen ganz kurzen?“
Manfred hatte durchaus nichts dagegen – es würde der erste Programmbeitrag überhaupt sein.
„Du kannst Dich ruhig länger fassen“, sagte er. „Wir sind 24 Stunden am Tag sendebereit.“
„Nicht nötig“, wehre Kulle ab. „Ich dachte nur an eine kurze Nachrichtensendung. So etwas Ähnliches wie die „Tagesschau“ bei den Menschen. Neuigkeiten aus aller Welt und natürlich hauptsächlich aus Bärenleben.“
„Das ist eine hervorragende Idee!“ Manfred strahlte begeistert. „Aber mit den Nachrichten aus Bärenleben wirst Du wohl Schwierigkeiten bekommen – hier passiert doch nichts! Oder willst Du Tumus neueste Kochrezepte vorstellen?“
Warum eigentlich nicht?“ schmunzelte Kulle. Deine Mutter kocht ganz hervorragend. Aber ich dachte an etwas anderes. Laß mich nur machen…“
„Klar laß ich Dich machen. Brauchst Du technische Unterstützung?“
„Danke, ich glaube nicht. Sag mal…“ Kulle strich nicht ohne Eitelkeit über seine Fliege. „Ist die schön genug fürs Fernsehen, oder brauche ich eine neue Krawatte?“
„Was soll an Deiner Fliege falsch sein? Du brauchst nichts anderes. Außerdem – ohne Dein Markenzeichen würde Dich vermutlich niemand erkennen!“
Das sollte ein Scherz sein, aber Kulle fand es wert, ernsthaft über diese Aussage nachzudenken. Sie schien ihm so wichtig zu sein, daß er das Gespräch abrupt beendete und in Gedanken davonstapfte.
Bevor er außer Hörweite war, rief Manfred ihm nach: „Wann soll die Sendung denn sein?“
„In der Dämmerung, kurz vor der Abendversammlung“, brüllte Kulle zurück. „Dann können hinterher alle darüber reden!“
Manfred leistete gute Vorarbeit. Auf seinen überall sichtbaren Monitoren erschien am späten Nachmittag eine Ankündigung:
Erste Nachrichtensendung des Bärenlebendigen Fernsehens
heute in der Dämmerung.
Guckt alle!
Jeder Bär, jede Bärin bekam die Information mit, und alle waren so neugierig, daß sie sich vor dem großen Bildschirm in der Versammlungshöhle einfanden, als die Sonne noch recht hoch am Horizont stand. Sie machten es sich gemütlich, aber ihre Aufregung wurde durch die zahllosen Fragen deutlich, die wie ein Bienenschwarm durch die Spätsommernacht schwirrten: Was für Nachrichten? Wozu überhaupt? Wer hatte die Sendung gemacht? Hatte Manfred Fernsehprofis angeheuert?
Niemand löste die Rätsel, bis die Abendröte verblaßt war und der Himmel sich auch im Westen allmählich dunkelblau färbte. Manfred, den viele suchten, blieb unsichtbar. Dann aber verschwand die Schrifttafel auf den Monitoren, die Bildschirme wurden für eine kurze Zeit grau, und danach erschien für ein paar Sekunden lang ein Film, der zwei spielende Bärenjunge zeigte.
„Das sind Peter und Paul!“ wurde überall gerufen, und die Bären hauten einander die Pranken auf die Schultern. Die beiden Brüder waren bei jedem im Dorf bekannt; sie liebten es, sich zu balgen – eigentlich war ihr Anblick also nichts Besonderes. Aber es war das erste Mal, daß die Bären von Bären gefilmte Bären im Fernsehen sahen. Also schauten sie mit Begeisterung zu.
Nach dem Ende der Balgerei erschien ein Schriftzug: DER TAG. Nachdem er langsam ausgeblendet worden war, sahen die Zuschauer einen Schreibtisch mit einem Mikrofon darauf. Dahinter saß ein kleiner, gedrungener Bär, der einige Papierblätter in den Pfoten hielt. Er trug eine große Brille mir dunklen Gläsern, so daß seine Augen nicht erkennbar waren, und eine sonnengelbe breite Krawatte mit kühn geschlungenem Knoten.

„Guten Abend, liebe Bärinnen und Bären in Bärenleben“, sagte er. „Ich begrüße Euch zur ersten
DER TAG
– Sendung unseres Dorffernsehens. Unser Mitbär Manfred hat viel Arbeit investiert, um uns dieses neue Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen.“
Die meisten Bären brummten ihre Zustimmung, aber leise erhob sich hier und dort auch Unmut: „Manfred hätte seine Zeit nützlicher verbringen können.“ „Wozu brauchen wir dieses Fernsehen überhaupt?“ „Was wir bis jetzt gesehen haben, kennen und wissen wir doch alles!“
Der unbekannte Nachrichtensprecher bemerkte von alldem natürlich nichts. Er fuhr unbeirrt fort:
„Ich komme jetzt zu den heutigen Nachrichten.“
Er senkte seine unsichtbaren Augen auf das erste Blatt und las:
„Washington. Der amerikanische Präsident Bill Clinton hat die Luftangriffe auf strategische Ziele im Irak als Erfolg bezeichnet. Zusammen mit der britischen Luftwaffe fliegen Einheiten der US-Airforce seit drei Tagen Angriffe mit Cruise Missiles auf zentrale Quartiere der Republikanischen Garden des Diktators Saddam Hussein und auf Industrieeinrichtungen, die zur Herstellung chemischer und biologischer Waffen dienen. Saddam sei bereits entscheidend geschwächt worden, sagte Clinton. Anschließend dementierte er Pressemeldungen, die den Angriff in Zusammenhang mit dem dem Präsidenten drohenden Impeachment gebracht hatten. Wegen außerehelicher Beziehungen, die Clinton lange Zeit geleugnet hatte, droht ihm ein Amtsenthebungsverfahren.“
Der Nachrichtensprecher legte das erste Blatt beiseite.
Die Bären hatten aufmerksam zugehört, aber in der Pause, die jetzt entstand, wurde deutlicher Unmut laut.
„Das wissen wir alles schon!“
„Schließlich lesen wir Zeitungen!“
Als der Sprecher wieder den Mund öffnete, wurde es still.
„Bärenleben. Der Dorfpräsident hat die Vergeltungsmaßnahmen gegen die Nachbarorte Bienenleben und Mauseleben verteidigt. Bienen und Mäuse hätten zwei Grundnahrungsmittel der Bären, nämlich Honig und Beeren, für sich reklamiert und müßten deshalb in ihre Schranken verwiesen werden. Es sei folglich gerechtfertigt, Mäusen den Zugang zu den Beerensträuchern zu verwehren, was mit Hilfe von Mausefallen geschehe, die sehr effektvoll arbeiteten. Wegen der Artunterschiede sei das Vorgehen gegen die räuberischen Bienen zwangsläufig anderer Natur; ihnen werde der in den Stöcken zusamengetragene Honig weggenommen und durch Zuckerwasser ersetzt. Es sei nicht klug, die Kuh, die man melken wolle, zu schlachten. Anschließend dementierte der Dorfpräsident Gerüchte, denen zufolge er sexuelle Beziehungen zu seinem Sohn unterhalte. Er sei Zeit seines Lebens heterosexuell und monogam gewesen.“
Der Sprecher legte auch das zweite Blatt zur Seite und begann unverzüglich, die dritte Seite vorzulesen.
„Es folgt der Wetterbericht. Ein Hoch über Norddehland sorgt für…“
Das Folgende ging im Tumult der Zuschauer unter. Alle redeten durcheinander.
„Ungeheuerlich!“
„Wer soll denn dieser Dorfpräsident sein?“
„Was für ein Quatsch – ein Präsident in einer libertären Gemeinschaft!“
„Ich kann das gar nicht glauben – Krieg gegen Mauseleben und Bienenleben…“
„Bestimmt eine Falschmeldung!“
„Wer ist eigentlich dieser Nachrichtensprecher?“
„Fürchterlich – die armen Mäuse und Bienen…“
„Daß ein Bär inzestuöse Beziehungen abstreitet, kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen!“
„Woher kommt bloß diese Meldung?“
In der kurzen Pause, die nach der ersten Aufregung entstand, wiederholte eine alte Bärin die Frage, die sie schon einmal gestellt hatte:
„Wer soll denn dieser Dorfpräsident sein?“
Jetzt hatten alle Bären zugehört und schauten einander an. Ja, wer käme in Frage, wenn an dieser ungeheuerlichen Meldung auch nur ein Quentchen Wahrheit wäre?
„Gibt es eigentlich jemanden von uns, der nicht hier ist?“ fragte schließlich ein junger Bär. Er war in Manfreds Alter und wußte nicht so recht, warum er diese Frage gestellt hatte. Um so überraschter war er von der Reaktion, die erfolgte.
„Das ist wahrhaft bärische Intelligenz“, brummte ein Alter. „Natürlich ist der Schuldige nicht anwesend, wenn seine Schandtat öffentlich bekannt wird. Falls es einen Schuldigen gibt – in dubio pro reo urso. Aber trotzdem: Wer fehlt?“
Es war nicht leicht, in der Dunkelheit alle Gesichter auszumachen, aber dennoch hatten sie nach kurzer Zeit die Lösung. Nur einer fehlte – Bärdel.
„Bärdel!!“ Kaum einer konnte es sich verkneifen, den Namen vor sich hinzuflüstern. Trotz der stimmlosen Artikulation war der Unglaube hörbar. Bärdel, ausgerechnet Bärdel sollte solche Untaten begangen haben?
„Alles Quatsch!“ Tumu meldete sich zu Wort. „Ich weiß nicht, warum Bärdel jetzt nicht hier ist, bei dieser sogenannten Premiere, die mir eher eine Schmierenkomödie zu sein scheint. Vielleicht hat er das geahnt und ist deshalb zu Hause geblieben. Mir fällt ein guter Weg ein, um herauszubekommen, warum er nicht hier ist und was es mit den Anschuldigungen auf sich hat: Gehen wir hin und fragen ihn!“
Die Versammlung brummte Zustimmung. Die Höhle leerte sich, und der Bildschirm, auf dem die Nachrichtensendung inzwischen zu Ende gegangen war, blieb verwaist zurück. Alle waren auf dem Weg zu Bärdels Privatquartier.
Als sie die Brombeerbüsche passierten, die mitten im Dorf wuchsen, schrie ein junger Bär plötzlich auf und rannte anschließend hinkend umher, wobei er erbärmlich quiekte – bei Bären der Ausdruck höchsten Schmerzes. Seine Mutter setzte ihm mit tröstenden Brummtönen nach, alle anderen gerieten in höchste Unruhe, weil sie sich auch in Gefahr wähnten. Nur Tumu behielt die Nerven.
„Licht!“ rief sie.
Wie von Geisterhand erleuchtete wenige Sekunden später eine helle Glühbirne die Szenen genau an der richtigen Stelle – Manfred hatte die Beleuchtung von Bärenleben, die er ganz nebenbei installiert hatte, partiell aktiviert.
Der Fuß des jungen Bären, das konnten alle sehen, steckte in einer Mausefalle und wurde grausam gequetscht.
Sofort schlug die Stimmung um.
„Es ist also doch wahr,“ kreischte eine junge Frau hysterisch, „Bärdel führt Krieg gegen Mauseleben! Er hat sich zum Diktator gemacht! Richten wir ihn!“
Ohne zu überlegen folgten die Bären ihr, als sie entschlossen weiter in Richtung auf Bärdels Höhle zustapfte. Nur Tumu und der junge verletzte Bär blieben zurück. Mit großer Kraftanstrengung gelang es ihr, die Falle zu öffnen und den Fuß des Jungen zu befreien.
„So, Kleiner“, sagte sie danach und wischte ihm über das Gesicht, um die Schmerz- und Schrecktränen abzutrocknen, „jetzt ist es wieder gut. Dein Fuß ist heil – er ist deutlich stabiler als eine Maus. Geht‘s wieder?“
Er nickte.
„Gut – ich muß mich jetzt nämlich beeilen. Die haben gerade geklungen, als wollten sie meinen Mann vierteilen. Und das hätte ich ungern, zumal er ganz sicher unschuldig ist.“
Sie eilte davon und geriet vor ihrer Wohnhöhle in eben die Szene, die sie befürchtet hatte. Bärdel stand im Eingang und erwehrte sich verbaler Angriffe, aber nach jeder seiner Antworten rückten die Bären drohend einen Schritt weiter vor.
„Warum hast Du unsere Gemeinschaft zerstört?“ – „Was soll ich gemacht haben?“
„Kriegstreiber!“ – „Ich führe keinen Krieg, gegen niemanden!“
„Und was ist mit der Mausefalle?“ – „Von welcher Mausefalle redest Du?“
„Hast Du mit Manfred geschlafen?“ – „Soweit ich weiß, ist Sex auch bei Bären Privatsache!“
Die junge Frau, die sich eben schon hervorgetan hatte, erhob ihre kreischende Stimme über die aller anderen und brachte sie zum Schweigen.
„Er leugnet das Richtige und dementiert das Falsche!“ heulte sie. „Oder umgekehrt. Jedenfalls lügt er. Ich finde, daß er bei uns in Bärenleben nichts mehr zu suchen hat!“
Zustimmung wurde laut, aber bevor die Bären handgreiflich werden konnten, was sie am liebsten getan hätten, hob eine Alte die Pranke.
„Alles muß seine Richtigkeit haben“, sagte sie. „Lynchjustiz wird es in Bärenleben nicht geben, wohl aber demokratische Rechtsprechung. Wer der Meinung ist, daß Bärdel unser Dorf wegen Verletzung der politischen Regeln unserer Gemeinschaft und wegen grober Verstöße gegen die Tierrechte verlassen muß, der hebe die Tatze!“
Selbst in der nur vom Licht der Sterne erhellten Nacht war deutlich sichtbar, daß eine große Zahl von Armen in die Luft gereckt wurde.
„Gut“, stellte die Sprecherin fest. „Machen wir die Gegenprobe!“
Zwei Hände zeigten sich. Eine gehörte Tumu und die andere dem jungen Bären, der in die Falle geraten war. Sein Arm schwankte, denn er atmete schwer. Er war gerade rechtzeitig zur Abstimmung atemlos vor Bärdels Höhle angekommen.
„Zwei Gegenstimmen also.“ Die alte Bärin zögerte nur wenige Sekunden, bevor sie fortfuhr. „Aber die überwältigende Mehrheit hat sich für Bärdels Verbannung ausgesprochen. Er muß Bärenleben verlassen!“
„Und seine Frau auch!“ kreischte jemand, der anonym in der Menge verborgen blieb.
„NEIN!“ sagte da eine Stimme aus dem Off. Sie klang gebieterisch, und einen Moment lang glaubten einige Bären, sie gehöre Tussi. Aber dann besannen sie sich: Hier sprach keine Frau, sondern ein Mann.
„NEIN!“ ertönte die Stimme nochmals. „HÖRT MIR ZU!“
Es wurde so still, daß das Sirren der Mücken in den Ohren der Bären laut wie das Heulen von Sirenen dröhnte.
Die herrische Stimme wurde zur Stimme des anonymen Nachrichtensprechers.
„Bärenleben. Die Bewohner des idyllischen Dorfes haben heute eine schwere Niederlage erlitten. Sie haben dem Zorn gehorcht und nicht der Vernunft und dabei Prinzipien verletzt, die seit Jahr und Tag bewährte Regeln der Gemeinschaft dargestellt haben.“
In der Dunkelheit suchten die Bären die Augen ihrer Nachbarn. War das wahr? Zuerst konnten sie einander kaum erkennen, dann aber hoben sich die Gesichter aus der Schwärze. Das Fernsehen war wieder zum Leben erwacht und tauchte die versammelte Gemeinde in ein graues Licht. Auf dem vor Bärdels Höhle installierten Bildschirm tauchte das Gesicht des Nachrichtensprechers auf.
„Ja, das ist wahr“, sagte er, als könnte er ihre Gedanken lesen. „Ihr habt eine Mehrheitsentscheidung gefällt und damit das Konsensprinzip ignoriert. Ihr habt einen Mitbürger verurteilt, ohne ihn angemessen gehört zu haben. Ihr habt – mit einer Ausnahme, nämlich Tumu – einem verletzten Mitbären Hilfe verweigert. Ihr habt Indizien so bewertet, daß sie in Eure unbewiesenen Theorien paßten – ich meine die Mausefalle. Menschenkinder haben die Falle vor ein paar Stunden in unserem Dorf aufgestellt, während wir alle Mittagsschlaf gehalten haben. Und schließlich – und das ist das Geringste und das Schlimmste zugleich, weil es eigentlich harmlos sein könnte und doch der Auslöser für all Eure Fehlhandlungen war – Ihr habt Nachrichten geglaubt, die Lügen waren. Ihr habt ihnen geglaubt, weil sie von einer scheinbar höheren Instanz kamen – dem Fernsehen. Ich fasse zusammen: Ihr habt Euch also benommen wie Menschen!“
Der Sprecher schwieg, und auch unter den Bären war es still. Erst nach einer Weile wurde das Geräusch von vorsichtig auftretenden Pfoten ahnbar, wenn man ganz genau hinhörte – die Bären begannen, sich wortlos davonzustehlen, weil sie sich schämten. Deshalb sahen längst nicht mehr alle, daß der Bär im Fernsehen die dunkle Brille absetzte und die Krawatte vom Hals zog. An der Stelle, an der die Krawatte gesessen hatte, kam eine bunte Fliege zum Vorschein. Aber Bärdel sah es, Tumu sah es, und Manfred sah es. Sie sahen Kulle.
„Du…“ sagten alle drei gleichzeitig, und sechs Bärenfäuste ballten sich.
„Schon gut“, meinte Kulle, als würde er mitbekommen, was außerhalb des Studios vor sich ging. „Ich habe Euch beschissen, vor allem Dich, Bärdel. Aber ich hatte die Situation immer voll im Griff, das kannst Du mir glauben. Hätte ich Dich eingeweiht, hättest Du Deine Rolle wohl kaum so überzeugend gespielt wie eben. Den Bären wollte ich zeigen, wie Fernsehen wirkt – das dürfte mir gelungen sein. Bären sind eben auch nur Menschen.“
„Falsch!“ schimpfte Tumu. „Immerhin haben die Bären die angebliche Kriegführung ihres angeblichen Präsidenten verurteilt und nicht gutgeheißen, und die angeblichen sexuellen Verfehlungen ihres angeblichen Präsidenten haben sie vermißt, weil sie sie begrüßt hätten – das macht doch wohl einen deutlichen Unterschied!“
„Mama“, sagte Manfred. Er redete mit seiner Mutter, weil er fühlte, daß sein Vater momentan nicht ansprechbar war. „Mama, ich werde das Dorffernsehen wieder abbauen. Denn…“
Ihm fiel keine griffige Begründung ein, aber seine Mutter wollte gar keine hören.
„Gut.“ sagte sie nur.
Kulle schien gewartet zu haben, bis der Dialog zu Ende war. Seine braunen Knopfaugen suchten die Kamera, und er blickte seine Zuschauer direkt an.
„Bärdel, bist Du mir noch böse?“ fragte er.
„Ja.“
Mehr sagte Bärdel nicht, und Kulle schien mit dieser kurzen Antwort gerechnet zu haben.
„Ich wußte es“, tönte es aus den Lautsprechern. Bärdel sah kurz auf den Bildschirm und registrierte, daß Kulle nervös zwinkerte und an seiner Fliege nestelte.
„Ich möchte Dir noch eine Frage stellen, wenn ich darf.“ Kulles Stimme klang gepreßt. Natürlich konnte er Bärdels Reaktion nicht erkennen.
Unabhängig von einer Erlaubnis fuhr er also fort: „Hättest Du Dich korrekt verhalten, wenn Du heute abend unter den Fernsehzuschauern in Bärenleben gewesen wärest?“
Vor Bärdels Höhle herrschte Stille. Hand in Hand saßen er und Tumu da. Nach einer Weile hörte man ein hartes, kurzes Zischen.
Mitten in das Geräusch hinein flüsterte Bärdel: „Ich weiß es nicht.“
Der Bildschirm vor Bärdels Höhle und alle anderen Bildschirme in Bärenleben wurden dunkel. Manfred hatte das Fernsehen abgeschaltet.
Bärenbesuch
Es schien ein ganz normaler Abend in Bärenleben zu sein. Am Ende der Höhlenversammlung, in der sie die Neuigkeiten des Tages ausgetauscht und einander Geschichten erzählt hatten, gähnten alle Bären und auch das Schwein zufrieden und müde und rappelten sich auf, um ihre Schlafplätze aufzusuchen. Kulle jedoch verschaffte sich in der allgemeinen Unruhe Gehör.

In das verblüffte Schweigen, das dieser Ankündigung folgte, platzte das Schwein hinein.

Kulle war sichtlich geschmeichelt, denn er strich sich liebevoll über seine Fliege – ein untrügliches Zeichen von Eitelkeit.
„Nun ja – selbstverständlich sind wir Bären in Bärenleben hier wichtig, nicht zuletzt die Intellektuellen unter uns.“
Er schaute sich aus den Augenwinkeln um und prüfte, ob jemand die Anspielung, die einen indirekten Angriff auf die nichtintellektuellen Bären enthielt, verstanden hatte. Aber niemand runzelte die Stirn. Man kannte hier Kulles Überheblichkeit und nahm sie schmunzelnd hin, oder man verstand seine nicht immer einfachen Aussagen tatsächlich nicht.
„Aber es gibt auf dieser Welt einen Bären, den niemand von uns kennt. Er ist ein Einzelgänger – völlig bärenuntypisch. Er bewegt sich viel unter den Menschen, ohne daß sie ihm zur Gefahr werden. Er mischt in ihren sogenannten höchsten Kreisen mit – in der Politik, in der Wirtschaft, bei wichtigen Konferenzen. Er scheint es zu schaffen, die Entscheidungen der Menschen in seinem Sinne zu beeinflussen – und das ist viel mehr, als wir hier können. Deshalb möchte ich ihn unbedingt treffen.“
„Wer ist das denn?“
„Woher weißt du von ihm?“
„Er heißt Grizzy, und ich habe kürzlich in einer Zeitschrift ein Interview mit ihm gelesen. Der dehländische VIP-Aufenthaltskalender im Internet hat mir verraten, daß er sich heute und morgen in der Hauptstadt aufhält. Natürlich, wie es seine Art ist, im ersten Hotel am Platze, also im Adlon.“
„Was kostet denn so eine Nacht im Adlon?“ wollte das praktisch veranlagte Schwein wissen.
„Das kommt darauf an. 500 DM fürs Doppelzimmer, schätze ich mal, und bis zu 2000 DM für eine Suite. Grizzy hat garantiert eine Suite gebucht.“
„Ist das viel oder wenig Geld?“ fragte eine alte Bärin, die zeitlebens nicht mit diesem merkwürdigen Tauschmittel, das die Menschen so hoch schätzten, in Berührung gekommen war.
Die meisten Anwesenden waren ähnlich ratlos wie sie, aber Manfred hatte eine Antwort:
„Wenn ich meine Computer ehrlich erworben hätte, hätte ich für ein einfaches Modell ungefähr 2000 DM bezahlen müssen. Soviel kostet ja schon der neue iMac.“
Niemand in der Runde wußte, was der neue iMac war, und alle gingen diskret über die Bemerkung hinweg, derzufolge Manfred seinen Computerpark nicht auf legale Weise aufgebaut hatte. Allen aber bleib der Eindruck: 500 DM für ein Bett in der Nacht, oder gar 2000, waren verflixt viel Geld.
„Woher hat dieser Grizzy so viel Geld?“ erkundigte sich Tumu mit tiefen Falten auf der Stirn. Den Verdacht, der ihr gerade gekommen war, mochte sie überhaupt nicht. Ob er mit den Menschen gemeinsame Sache machte?
„Ich weiß es nicht.“ Die Antwort fiel Kulle sichtlich schwer. Er gab nun mal nur ungern zu, etwas nicht zu wissen.
„Aber ich möchte es gern herausbekommen.“
„Das und dieser Bär überhaupt interessiert mich aber auch! Uns alle wahrscheinlich!“ Das Schwein war vor lauter Aufregung purpurrot angelaufen, den es hatte es noch nie gewagt, im Kreise seiner Gastgeber eine eigene Meinung zu vertreten.
„Warum laden wir ihn nicht einfach nach Bärenleben ein? Er könnte doch hierher kommen, nachdem er mit seinen Geschäften in der Hauptstadt fertig ist.“
Zustimmendes Gebrumm erhob sich. Kräftige Pranken schlugen dem kleinen Schwein anerkennend auf die Schultern, so daß es japsend zu Boden ging. Dennoch strahlte es angesichts der allseitigen Anerkennung über das ganze Gesicht.
Kulle jedoch war anderer Meinung und äußerte Bedenken.
„Ich weiß nicht…“ sagte er langsam.“Dieser Grizzy ist ein Einzelgänger, wie ich schon erwähnte, und dem einfachen Bärenleben längst entfremdet. Ich glaube nicht, daß er bereit sein wird, den Komfort, an den er gewöhnt ist, gegen das Leben bei uns einzutauschen, und sei es auch nur für kurze Zeit.“
Bärdel schmunzelte. Schließlich kannte er Kulle lange und gut genug, um ihn zu durchschauen.

„Superidee!“ jubelte Manfred. Ich schicke ihm gleich ein email!“
Kulle grummelte zwar, aber gegen diesen Vorschlag fielen ihm keine Argumente mehr ein. Jetzt brachen alle wirklich auf und gingen schlafen. Nur Manfred verbrachte noch ein paar Minuten am Computer. In demselben Moment, in dem er fertig war, ging im Hotel Adlon‘ eine Nachricht ein.
betrifft: Bärenbesuch
Alle Bewohner von Bärenleben laden Dich hiermit herzlich in unser Dorf ein, sobald Du kommen kannst. Wir haben von Dir gehört und sind sehr neugierig auf Dich. Wenn Du zusagst, werden wir Dir verraten, wie Du uns findest. Wir leben nämlich vor den Menschen versteckt. 😉 im Auftrag aller Manfred.
Am nächsten Morgen war die Antwort bereits eingegangen. Auf dem Bildschirm erschienen die Worte:
betrifft: Bärenbesuch
Schönen Dank für die Einladung. Ich nehme hier gerade an Gesprächen zwischen der dehländischen Regierung und der Atomindustrie teil. Das dürfte zwei oder höchstens drei Tage dauern. Anschließend komme ich gerne zu Euch. Eine Wegbeschreibung brauche ich nicht – ich weiß, wo Bärenleben ist. 😉 Grizzy
Manfred, der als erstes am Morgen immer seine Post abholte‘, wie er das nannte. verbreitete die Nachricht sofort. Unruhe war die Folge.
„Woher weiß dieser Bär, wo wir wohnen?“
„Was ist, wenn er uns verraten hat – dann sind wir den Menschen schutzlos ausgeliefert!“
„Er braucht uns noch nicht einmal absichtlich zu verraten! Wenn er hier mit einem Privathubschrauber einfliegt, ist das für die Menschen Information genug! Oder wie will so ein degenerierter Bär sonst zu uns kommen?“
Bärdel bemühte sich redlich, die Wogen zu glätten.
„Nun mal langsam“, sagte er.“Anscheinend weiß dieser Grizzy, wo wir leben – nun gut. Wenn er uns hätte verraten wollen, hätte er es also längst tun können. Und vorsichtig wird er auch sein – wer sich so lange und erfolgreich unter den Menschen bewegt wie er, muß das einfach. Wir sollten uns also erstmal nicht aufregen. Im übrigen halte ich es mit diesem Menschen, den Kulle so häufig zitiert. Der hat doch mal gesagt, daß den Menschen zum richtigen Zeitpunkt für selbstgemachte Probleme immer die richtigen Lösungen einfallen, oder so ähnlich. Was für die Menschen gilt, trifft auf uns Bären allemal zu!“
Kulle nickte zögernd und murmelte etwas von Karl Marx und dem für das 19. Jahrhundert typischen Optimismus in seine Fliege, aber die meisten Bären registrierten nur das Nicken. Allmählich beruhigten sie sich. Das bedeutete jedoch keineswegs, daß sie zur üblichen Tagesordnung übergingen.
„Gut, Bärinnen und Bären! Wir bekommen also hohen Besuch! Dessen müssen wir uns würdig erweisen. Die Männer sollten eine Organisationskonferenz abhalten, und für uns Frauen berufe ich hiermit sofort ein Back- und Kochtreffen ein!“
Das war Tumu, und ihr Vorschlag fand Zustimmung.
Sie berieten jeweils zwei Stunden lang und arbeiteten hinterher zwei volle Tage. Danach war Bärenleben so sauber wie noch nie. Auf dem zentralen Dorfplatz prangte ein Partyzelt, in dessen Mitte ein Bett mit Matratze, Daunendecken und weißer Satinbettwäsche einladend aufgeschlagen war. An kühlen schattigen Plätzen und in heißen Erdöfen warteten Köstlichkeiten für ein opulentes Festmahl.
Es versteht sich von selbst, daß die Menschen, die in der näheren und weiteren Entfernung von Bärenleben wohnten, den einen oder anderen Besitz vermißten. Aber keiner von ihnen erstattete Anzeige. Was da verschwunden war, waren keine sogenannten Wertgegenstände. Die Diebe, vermuteten sie, waren Obdachlose oder vagabundierende Banden aus Osteuropa. Mit den ersten hatten sogar die meisten Menschen Mitleid, und den zweiten, so sagte ihnen ihre Erfahrung, kam man sowieso nicht auf die Schliche.
Nachdem sie fertig waren, warteten die Bären. Sie lauschten auf das Flap-Flap eines Helikopters oder auf sich nähernde Sirenen einer Polizeieskorte, aber nichts dergleichen ließ sich hören. So gingen sie schließlich schlafen.
Auch am nächsten Morgen schien alles unverändert. Sie sahen sich um, schnupperten in die Sommerluft, die wie immer roch und schmeckte, zuckten mit den Schultern und machten sich endlich daran, ihrer üblichen Beschäftigung nachzugehen. Das hieß vor allem Fressen – in den letzten Tagen waren sie vor lauter Arbeit kaum dazu gekommen. Hungrig waren sie jetzt alle.
Manfred und seine Freunde machten sich in die Himbeerhecken auf, die in zehnminütigem zügigem Bärentrab zu erreichen waren. In gemütlichem Bärentrott dauerte der Weg eine halbe Stunde, und das war den älteren Bären meist zu lang. Die Jungbärenhorde hatte die Sträucher deshalb in der Regel für sich.
In der Regel.
Als sie sich heute den süßen Früchten näherten, hörten sie schon von Ferne lautes Knacken von Zweigen und ein kräftiges Schmatzen. Wie auf Kommando blieben alle stehen.
„Da ist jemand!“ flüsterte Manfred völlig überflüssigerweise.
„Ein Mensch!“ sagte ein Jungbär, der kaum das Halbstarkenalter erreicht hatte.
Auch diese Bemerkung war unnötig. Wer sollte es sonst sein?
„Okay, strategischer Rückzug!“ kommandierte Manfred.“Wir warten, bis er fertig ist, und kommen später wieder!“
„Wie wollt Ihr wissen, wann ich fertig bin, wenn Ihr jetzt weggeht?“ röhrte eine tiefe Stimme aus dem Gebüsch. Das Schmatzen hatte aufgehört, aber nach wie vor hörten sie das Geräusch zerbrechender Äste.
Zum ersten Mal in seinem Leben gelang Manfred das, was er sich immer gewünscht hatte: Sein Gehirn arbeitete so schnell und so präzise wie ein Computer.
Dieses Wesen da im Gesträuch konnte kein Mensch sein, denn das menschliche Gehör war nicht sensibel genug, um die vorsichtige Annäherung der Bären zu registrieren. Außerdem benutzte das Wesen die Bärensprache, war also mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bär. Die einzigen Bären aus Bärenleben hier waren er und seine Freunde; also war dieser Bär nicht aus Bärenleben. Zudem erwartete man in Bärenleben Bärenbesuch.
Manfred nahm all seinen Mut zusammen und ging, ohne eine Tarnung zu suchen, auf die Himbeerhecken zu. Als er unmittelbar davorstand, sagte er:
„Herzlich willkommen und guten Tag, Grizzy. Ich bin Manfred.“
Das Schmatzen setzte wieder ein, gefolgt von einem vernehmbaren Schlucken.
„Darauf eine Handvoll Himbeeren! Ich habe lange nicht mehr so etwas Köstliches gegessen. Du bist also vermutlich derjenige, der mir das email geschickt hat. Wartet, ich komme raus! Oder wollt Ihr reinkommen? Ich habe zwar einen bärenmäßigen Appetit, aber es sind genug Beeren für alle da!“
Manfred zog es vor abzuwarten, und seine Freunde waren immer noch starr vor Schreck. So teilte sich das Gestrüpp nach einer Weile, und tatsächlich erschien Grizzy.

Unwillkürlich wandten sich die Jungbären zur Flucht, und auch Manfred konnte nicht anders, als ein paar Schritte zurückzuweichen, obwohl er sich fest vorgenommen hatte, keine Furcht zu zeigen. Die dehländischen Braunbären hatten eben noch nie einen ausgewachsenen Grizzly zu sehen bekommen.
„Keine Panik!“ brummte Grizzy und grinste breit.“Ich komme in friedlicher Absicht, wie früher immer die weißen zu den roten Menschen zu sagen pflegten, bevor sie sie ermordeten oder im Alkohol ertränkten. Aber man kann sowas ja auch ernst meinen. Hier – ich habe Euch Himbeeren mitgebracht.“
Er streckte seine Pranken aus, mit den Handflächen nach oben. In den riesigen Händen glänzten zwei einladende Beerenhäufchen.
Manfred faßte zwei seiner Freunde, die neben ihm standen, legte die Arme um ihre Schultern und zog die Widerstrebenden mutig näher.
„Wir begrüßen Dich in unserem Dorf“, sagte er, als er unmittelbar vor Grizzy stand.“Oder fast – ein paar Minuten sind es noch. Dort wird man Dich angemessen willkommen heißen. Vorerst danken wir für Dein Geschenk.“
Er löste die Arme von seinen Freunden und griff in die riesigen Pranken. Als die anderen Bären sahen, daß Manfred nicht zerquetscht wurde, taten sie es ihm nach, und im Nu waren die Himbeeren verschwunden.

Dort wedelte eine alte Bärin mit einem Holunderzweig Blütenblätter und kleine Aststückchen fort, die der Wind in der vergangenen Nacht dorthin geweht hatte.
„Hau ab!“ knurrte sie Manfred an, als er direkt auf sie zukam. Sie sah nicht auf.“Hier ist jetzt kein Durchgang. Alles für den hohen Gast!“
„Ich nehme an, ich bin der hohe Gast!“ Grizzy meldete sich kichernd zu Wort.
Die Jungbären blickten einander verunsichert an – wie konnte ein so großer Bär mit so hoher Stimme kichern?
Aber Grizzy kehrte sich nicht an ihre Verwunderung. Er hatte das Partyzelt erblickt. Es stand offen, und der Blick auf das Luxusbett im Inneren war frei.
„Für mich?“ Grizzy gluckste weiter.“Ich will Euch ja nicht zu nahe treten, aber Ihr ahnt gar nicht, wie ich sowas hasse. Als ich Eure Einladung erhielt, habe ich mich auf nichts mehr gefreut als auf ein hartes ordentliches Bärenlager in einer gemütlichen gemeinsamen Schlafhöhle. Ich hoffe, Ihr habt nicht auch noch extra für mich gekocht – ich habe Appetit auf Beeren und Wurzeln und Honig. Forellen, fette fleischige Forellen wären auch nicht schlecht, direkt aus dem Fluß, aber das ist in Dehland wohl nicht drin. Macht nichts. Auf jeden Fall, hoffe ich, kann ich bei Euch Urlaub vom gekochten Menschenfraß machen.“
Schon bei Grizzys ersten Worten hatte sich die Alte aufgerichtet. Sie sah an ihm hoch – er war bestimmt zwei Kopflängen größer als sie – und lauschte ihm wortlos. Als er fertig war, ließ sie ihren Zweigbesen fallen, wandte sich um und trottete ohne Kommentar davon.
Manfred verabschiedete sich mit einer unverständlichen gemurmelten Entschuldigung hastig, und da sie nicht wußten, was sie sonst tun sollten, folgten ihm seine Freunde.
Grizzy blieb einsam auf dem Dorfplatz zurück. Er sah sich um und schmunzelte. Dann ließ er sich auf die Hinterbacken fallen, kratzte mit seinen Krallen ein Stück des festgetretenen Lehms locker und begann, ein Sandgemälde nach Navahoart zu verfertigen. Es würde ein Weilchen dauern, bis die Bärenlebener zurückkehrten, dachte er.
Er hatte recht. Es verging geraume Zeit, in der die Bärenfrauen den größten Teil der Nahrung, die sie in stundenlanger Arbeit nach Menschenrezepten zubereitet hatten, vernichteten. Dabei schimpften sie laut. Auch dauerte es lange, bis sich die Bärenmänner angesichts der neuen Situation auf einem Empfang geeinigt hatten, der ihnen angemessen erschien.
Zuerst waren alle dafür, daß Bärdel die Begrüßung übernahm, aber er wehrte sich nach Kräften.
„Das ist Kulles Sache!“ meinte er.“Er kennt Grizzy, zumindest von Ferne, und auch er hat ihn falsch eingeschätzt. Wir würde es da erst mir ergehen?“
Da Kulle bereit schien und den anderen keine Gegenargumente einfielen, war die Entscheidung gefallen.
Grizzy saß gemütlich auf dem Dorfplatz und gab seiner Sandzeichnung gerade den letzten Schliff – er hatte sie friedliche Bärenrückkehr‘ genannt – , als die Dorfbewohner sich von zwei Seiten näherten.
Von rechts kam die Frauen. Sie würdigten ihn keines Blickes, sondern zogen an ihm vorbei zum Zelt. Dort machten sie sich daran, das Bettzeug abzuziehen, das Bettgestell zu zerlegen und das Schutzdach abzubauen. Nach kurzer Zeit lag alles sauber gestapelt auf dem Boden.
Von links kamen die Männer, Kulle und Bärdel an der Spitze. Sie steuerten direkt auf Grizzy zu, und er stand respektvoll auf und wartete. Er war hier in einem traditionellen Bärendorf, und dort war es Sitte, daß die Gastgeber zuerst sprachen.
„Willkommen, Grizzy!“ sagte Kulle. Danach schwieg er.
Entsprechend der Bärenetikette war das eine äußerst kühle, unpersönliche Begrüßung, und Grizzy wußte das. Er wußte auch, warum das so war.
„Ich danke, Bewohner von Bärenleben, und bitte Euch um Entschuldigung. Ich habe alle Eure Erwartungen enttäuscht, und Ihr habt Euch meinetwegen unnötige Arbeit gemacht. Ich hoffe, Ihr gebt mir dafür nicht die Schuld. Es gehört zu meiner Lebensweise, daß niemand, der in der Welt der Menschen lebt, wirklich etwas von mir weiß. Was ich offiziell von mir verrate, soll und muß auf eine falsche Fährte führen. Ich habe es trotzdem gewagt, Eure Einladung anzunehmen, weil ich mich schon lange wieder einmal nach bärischer Lebensweise sehne, zumindest für eine Zeitlang. Deshalb bitte ich um Eure ganz selbstverständliche Gastfreundschaft, ohne allen Aufhebens.“
Die altmodische Schlußformel nahm Bärdel vorbehaltlos für Grizzy ein, aber Kulle gab sich nach wie vor skeptisch.
„Nochmals willkommen. Jeder Bär ist in Bärenleben willkommen.“
Bärdel runzelte ärgerlich die Stirn – das kam beinahe einer Beleidigung gleich. Grizzy gab sich jedoch unbeeindruckt.
„Wir geben zu, daß wir Dich nicht aus reiner Bärenliebe eingeladen haben. Wir erhoffen uns von Dir Information. Du lebst unter den Menschen, und…“
„…Und zwar in ihren höchsten Kreisen, und ich beeinflusse sie. Ich verfolge bestimmte Ziele. Selbstverständlich könnt Ihr darüber etwas hören. Wann wäre es denn recht?“
Kulle war ärgerlich wegen der unhöflichen Unterbrechung, aber andererseits wußte er, daß er selbst den Anlaß dazu gegeben hatte. Also riß er sich zusammen und sagte:
„Wie wär‘s mit heute Abend, in der Höhlenversammlung? Das entspräche gut bärischer Tradition, falls Du‘s vergessen haben solltest.“
Er hatte sich den letzten Satz nicht verkneifen können – wieder ein Angriff, und ein unnötiger dazu. Aber Grizzy ließ sich nichts anmerken.
„Gerne“, sagte er nur.
Am Abend in der Höhle war fast alles wie immer. Fast alles, denn alle hatten ihre gewohnten Plätze eingenommen. Allerdings saß in der Mitte der Versammlung ein riesiger grauer Bär, der freundlich um sich schaute. Die Bärenlebener waren verwirrt, denn dieser Bär mußte hungrig sein, und dennoch schien er heiter. Er konnte nichts gefressen haben, denn wann immer sie am Dorfplatz vorbeigekommen waren, hatten sie ihn gesehen, wie er dahockte und in sich versunken im Sand malte.
Tumu hatte Mitleid mit ihm und brachte ihm eine saftige Honigwabe, anmutig dekoriert auf einem Huflattichblatt.
„Iß!“ sagte sie.“Das ist Nervennahrung. Du wirst‘s brauchen können!“
Grizzy bedankte sich uns biß in die Wabe. Dabei blickte er sich um, zum ersten Mal bewußt. Er erkannte Manfred und seine Freunde, Bärdel, Kulle und die alte Bärin, die den Dorfplatz gereinigt hatte, und nickte ihnen zu. Als er das Schwein erblickte, mußte er lachen.
„Wer ist das denn?“
Tumu klärte ihn auf.
„Das Schwein? Es nennt sich selbst unseren politischen Asylanten. Das ist eine zwar ungewöhnliche, aber meiner Meinung nach richtige Einschätzung. Oder was hältst Du davon, wenn Dich andere umbringen wollen, nur weil Du bist, wie Du bist? Die Menschen wollten das Schwein schlachten, weil es ein Schwein ist.“
„Hm“, machte Grizzy.
Und dann eröffnete Bärdel offiziell die Versammlung.
„Bären“, sagte er,“wir haben heute einen ungewöhnlichen, illustren, prominenten Gast, der aber doch nicht so prominent ist, wie er sein könnte, weil er mit Vorliebe verdeckt operiert. Jeder von Euch weiß, von wem ich rede: Grizzy. Grizzy lebt alleine; zwar unter den Menschen, aber normalerweise ohne die Gesellschaft von Bären: also alleine. Grizzy ist von den Menschen akzeptiert, denn er besucht ihre wichtigsten Konferenzen – und er verfolgt dabei ein Ziel. Grizzy, wir wären Dir dankbar, wenn Du uns das näher erklären könntest.“
„Gerne“, sagte Grizzy.“Ich fange mal hinten an, wenn ich darf. Also: Ich will, daß die Menschheit von diesem Planeten verschwindet. Dazu tue ich mein Möglichstes.“
„Wenn ich mir das richtig überlege – und ich tue das zum ersten Mal – dann ist das gar keine so schlechte Idee“, bemerkte Tumu nachdenklich.
„Mama, Du spinnst ja! Und Du auch, Grizzy – entschuldige bitte, ich weiß, daß Du unser Gast bist. Woher soll ich denn meine Hardware und Software nehmen, wenn die Menschen weg sind?“ Manfred war empört.
Grizzy nahm die Herausforderung an.
„Wozu benutzt Du Computer und Programme?“
„Das ist ziemlich schwer zu erklären. Hast Du Erfahrung mit Computern?“
„Nur ein bißchen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wenn man ein System benutzt, das Informationen liefern kann, will man bestimmte Dinge über etwas Bestimmtes wissen. Also: Wozu benutzt Du Deinen Computer?“
„Tja, wenn Du das so siehst…“ Manfred dehnte seine Worte, er spielte auf Zeit. Grizzy ließ sie ihm und hütete sich, auch nur einen Laut von sich zu geben. Auch alle anderen Bären waren mäuschenstill.
„Letztendlich benutze ich den Computer, um etwas über Menschen zu erfahren“, gab Manfred schließlich zu. Er klang widerwillig. Schließlich hatte er aus der menschlichen Wissenschaft streng logische Schlußfolgerungen gelernt, und der Gedanke, zu dem Grizzy ihn gerade gezwungen hatte, behagte ihm gar nicht. Deshalb formulierte er ihn lieber selbst.
„Gut. Da ich Computer und Programme hauptsächlich brauche, damit wir Bären mit den Menschen fertig werden, werde ich Computer und Programme nicht mehr brauchen, wenn es keine Menschen mehr gibt. Erstmal hast Du gewonnen.“
Bewunderndes Brummen wurde laut – die Bären waren von so viel Scharfsinn begeistert. Auch das Schwein quiekte anerkennend. Allein Kulle wiegte skeptisch seinen Kopf, und auch Tumu schloß sich dem allgemeinen Beifall nicht an. Sie hatte nämlich gar nicht zugehört, sondern nachgedacht.
„Sag mal, Grizzy“, fragte sie, als die Unruhe sich wieder gelegt hatte. Was machst Du eigentlich, um das Verschwinden der Menschheit von der Erde zu bewirken?“
Das war natürlich eine hochinteressante Frage, und alle warteten gespannt auf die Antwort.
„Ich brauche gar nicht viel zu tun, denn die Hauptsache besorgen die Menschen selber. Sie vermehren sich unkontrolliert, und alle haben den Wunsch, so zu leben, wie ihre Artgenossen in den sogenannten entwickelten Industrieländern es ihnen vormachen. Also bemühen sie sich, möglichst viele unersetzbare Rohstoffe zu verbrauchen, und sie bewerkstelligen diesen Raubbau mit gefährlichen und die Umwelt zerstörenden Technologien. Die Triebfeder dafür ist ein den Menschen eigener Charakterzug: Habgier. Dazu kommt ihr artspezifisches kurzfristiges Denken. So weit, so gut.
Aber manchmal geschieht etwas Merkwürdiges, das gar nicht so recht zum allgemein menschlichen Verhalten passen will. Es ist sozusagen die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Manchmal tauchen Menschen auf, die darauf hinarbeiten, den Zerstörungsprozeß aufzuhalten oder gar umzukehren. Sie setzen sich zum Beispiel dafür ein, regenerative Energiequellen wie die Solarenergie anstatt von Kernkraft zu benutzen. Oder sie sind für Geburtenkontrolle. In solchen Fällen komme ich ins Spiel. Ich sorge dafür, daß diese Vernünftigen keine Chance haben. Zum Glück habe ich immer einflußreiche Verbündete, die über Geld oder ideologischen Einfluß verfügen. Am besten über beides, wie die katholische Kirche. Sie finanzieren mich auch, falls Ihr wissen wollt, woher ich mein Geld habe. Nach außen hin sieht es so aus, als ließe ich mich bestechen. Aber das stimmt natürlich nicht – man gibt mir nur Geld für das, was ich ohnehin will. Damit finanziere ich meinen aufwendigen Lebensstil, der mir allerdings keinen Spaß macht, wie Ihr heute mitbekommen haben dürftet. Aber für die Menschen, die die wichtigen Entscheidungen fällen, zählt jemand, der in einer Höhle wohnt, nichts.“
Und für Dich anscheind auch nicht‘, sagte Tumu, aber sie sagte es nur in ihrem Kopf. Bärdel jedoch, der neben ihr saß, spürte, daß sie kochte. Beruhigend griff er nach ihrer Pranke, aber sie entzog ihm die Pfote, stand auf und begann, in der geräumigen Höhle umherzuwandern. Nur mit Bewegung ließ sich ihre Erregtheit meistern. Die Bären betrachteten ihr ungewöhnliches Verhalten ruhig und aufmerksam. Schließlich blieb Tumu vor Grizzy stehen. Ihre Augen waren jetzt mit seinen auf gleicher Höhe, und das beruhigte sie. So flößte er ihr durch seine beeindruckende Statur keine Angst ein.
„Gut, Du arbeitest also darauf hin, daß dieser Planet unbewohnbar wird. Dann sterben die Menschen, das ist logisch. Was aber ist mit uns?“
„Ihr sterbt dann auch. Wir sterben dann auch.“ Die Antwort war emotionslos.
Grizzy hatte sich ein Stöckchen genommen und angefangen, auf dem Höhlenboden Bilder zu zeichnen. Den meisten Anwesenden sagten die Figuren nichts, aber Tumus beste Freundin, die sich in ihrer Freizeit mit Indianermythologie beschäftigte, erkannte die Muster. Einige Hopi, die nicht an die Allmacht der Geister auf den San Francisco Peaks glaubten, verwendeten diese Symbole. Sie stellten den Übergang von der vierten – der jetzigen – in die fünfte Welt dar.
„Aber die Ratten oder die Termiten oder die Kakerlaken oder wer auch immer, sie werden überleben. Die Evolution bekommt eine neue Chance. Eine notwendige neue Chance.“
„Hast Du Kinder?“
Jetzt war Tumus Stimme nicht mehr ruhig.
„Nein, natürlich nicht.“
„Natürlich nicht?“
Tumu konnte nicht verhindern, daß ihre Frage hysterisch klang. Was bildete sich dieser blasierte Bär ein!
„Was ist daran natürlich, keine Kinder zu bekommen? Ohne Kinder hätte Deine hochgelobte Evolution, seit sie die geschlechtliche Fortpflanzung erfunden hat, einpacken können! Hier – das ist Manfred!“
Tumu griff sich ihren sichtlich widerstrebenden Sohn, schleppte ihn in die Mitte der Höhle und stupste ihn direkt vor Grizzy unsanft auf den Boden.
„Mein Sohn! In ein paar Monaten wird er sich seine erste Freundin anlachen, vielleicht wird es etwas Festes, aber auch, wenn das nicht der Fall ist, mit irgendeiner Frau wird er Kinder zeugen. Und Du verurteilst diese Kinder schon heute zum Tode!“
Manfred war zwar sauer, weil seine Mutter ihn so vorführte, aber er hatte der Diskussion genau zugehört. Er hatte die ganze Zeit genau zugehört. Er hatte verstanden: Dieser fremde Bär wollte ihm nicht nur seine Computer wegnehmen, sondern auch seine Kinder umbringen!
Er zog die Lefzen zurück und bleckte die Zähne. Er war nicht allein. Emotional identifizierten sich alle Anwesenden mit Tumus Angriff. Sie begannen, ihre Ruhepositionen zu verlassen, und erhoben sich. Ein drohender Kreis schloß sich um Grizzy, der ruhig weitermalte. Aber Bärdel beherrschte sich, wenn es ihn auch viel Mühe kostete.
„Bären!“ mahnte er.“Bären! Wir haben einen Gast unter uns, der, das gebe ich zu, unbequeme Ansichten vertritt. Das berechtigt uns jedoch nicht, das Gastrecht zu verletzen. Wir sollten uns lieber auf unsere guten Traditionen besinnen: Wenn es unterschiedliche Ansichten sind, dann wird darüber geredet, bis die Kontroverse beseitigt ist. Das Faustrecht ist Jungbären unter sich vorbehalten!“
Manfred verstand den Rüffel und setzte sich wieder hin, und auch alle anderen Bären folgten seinem Beispiel. Das Schwein aber blieb stehen.
„Grizzy!“ sagte es. Seine Stimme klang ungewöhnlich tief, und daraus schlossen alle anderen zu recht, daß es sehr aufgeregt sein mußte.
„Grizzy! Du findest es also in Ordnung, daß die Menschen mich und meinesgleichen züchten, um uns aufzufressen? Denn wenn sie das tun und Massentierhaltung betreiben, pruduzieren sie jede Menge chemischer Stoffe, die letztlich ihnen selbst schaden, und sie sorgen für einen horrenden Gülleanfall, der die Landschaft verpestet und die Lebensqualität der Menschen mindert. Richtig?“
„Richtig!“ bestätigte Grizzy ungerührt. Noch immer ließ er sich in seiner Malerei nicht stören.
Jetzt hatte Bärdel es wirklich schwer, die Versammlung unter Kontrolle zu halten. Viele Bären hatten das Schwein liebgewonnen und waren angesichts der Vorstellung, daß es aufgefressen werden könnte, mit Abscheu erfüllt. Zornig rückten sie wieder gegen Grizzy vor.
„Kulle!“ rief Bärdel. Er wußte zwar auch nicht recht, was Kulle jetzt helfen konnte, aber er hatte das Gefühl, daß nur er die Situation retten konnte. Außerdem fiel ihm nichts Besseres ein.
Immerhin lenkte sein Ruf einige Bären ab. Sie schauten sich suchend um, konnten Kulle aber nicht entdecken. Da die Suche vergeblich blieb, war die Unterbrechung nur kurz. Wieder richtete sich alles Augenmerk auf Grizzy. Der Kreis um ihn zog sich enger.
„Kulle!“ rief Bärdel noch einmal. Seine Stimme zeigte Hoffnungslosigkeit. Er machte sich bereit, sich auf die angriffslustigen Bären zu stürzen. Einer mußte das Gastrecht in Ehren halten, und wenn es ihn sein Leben kostete.
In der Höhle, in der nur das hastige Atmen der Bären zu hören war, vernahm man plötzlich das Geräusch von rollenden Rädern, das sich näherte. Vor der Höhle stoppte es. Ein keuchender Kulle betrat den Raum.
„Entschuldigung!“ japste er.“Ich war mir nicht sicher, ob ich die Diskussion, die mir jetzt ja wohl bevorsteht, ganz allein bewältigen kann. Deshalb habe ich meine Bibliothek mitgebracht, zumindest einen Teil davon. Moment, ich bin gleich wieder da!“
Schon war er wieder draußen, aber wenige Augenblicke später kam er zurück und zog mit großer Anstrengung einen vierrädrigen Karren hinter sich her, der schwer beladen zu sein schien. Die Last war mit einer Plane bedeckt.
Kulle ließ den Kastenwagen achtlos stehen und näherte sich Grizzy.
„Das“, sagte er, wobei er auf den Karren wies,“ist nur für den Notfall. Ich hoffe doch, wir können uns jetzt von Bär zu Bär streiten.“
„Gerne“, erwiderte Grizzy höflich.“Allerdings, um ehrlich zu sein, ich möchte mich gar nicht streiten!“
„Das habe ich begriffen. Du hast uns ja schon abgeschrieben, wir sind fast tot. Und das sind wir deshalb, weil die Menschen sind, wie sie sind. Zumindest glaubst Du das. Die zufolge haben die Menschen einen unveränderlichen Charakter.“
Kulle legte eine Kunstpause ein. Grizzy nutzte die Chance, um zu nicken.
„Aber das ist Unsinn! Die Menschen sind gesellschaftliche Wesen, wie wir Bären auch. Anders als wir Bären haben sie während ihrer kurzen Existenz auf diesem Planeten die Art und Weise ihres gesellschaftlichen Zusammenlebens wiederholt modifiziert. Das hängt damit zusammen, daß sie auch ihre Art der Auseinandersetzung mit der Natur geändert haben, nicht kontinuierlich, sondern in Schüben. Sie wurden von Gejagten zu Koexistierenden und schließlich zu Jägern. Sie entwickelten das, was sie selbst als Zivilisation bezeichnen. Da das gesellschaftliche Gesamtprodukt aber nicht ausreichte, um allen Individuen das auf der jeweiligen Entwicklungsstufe mögliche Höchstmaß an Konsum zu verschaffen, entwickelte sich gleichzeitig eine Klassengesellschaft mit den ihr inhärenten Mechanismen, unter anderem Egoismus und Habgier. Habgier also“ – und jetzt hob Kulle sich auf die Zehenspitzen -„Habgier ist kein allgemein menschlicher Wesenzug, sondern das Ergebnis von Produktionsverhältnissen, die die Menschen geschaffen haben, ohne ihre Mechanismen und Auswirkungen zu verstehen.“
Kulle blickte stolz in die Runde. Er war überzeugt, Grizzy mit dieser Argumentation besiegt zu haben. Der aber zeigte sich unbeeindruckt.
„Schön“, sagte er und malte eine schwungvolle Linie auf den Boden.“Karl Marx. Deine Rede zeigt, daß Du ihn verstanden hast. Das kann kaum jemand sonst von sich behaupten. Aber dieser Marx war schließlich auch nur ein Mensch!“
„Na und?“ rief Kulle empört.“Keine Argumentation wird dadurch entwertet, daß sie aus sogenannter falscher Quelle stammt! Allein die Qualität zählt!“
„Schon wieder Marx!“ brummte Grizzy anerkennend.“Wobei er selbst sich übrigens nie an diese lobenswerte Maxime gehalten hat. Kennst Du den alten Knaben etwa auswendig?“
„Nein, das tue ich nicht!“
Kulle ging zurück zu dem Karren, den er mitgebracht hatte, und zog die Plane von der Ladung. Buchrücken wurden sichtbar.
„Leider ist das hauptsächlich die MEW und nur ein kleiner Teil der MEGA,“ entschuldigte er sich.“Ich kaufe jeden Band, sobald er erscheint, aber im wiedervereinigten Dehland verläuft die Edition äußerst schleppend.“
Kulle machte eine kurze Pause, und währenddessen faßte er einen kühnen Plan.
„Grizzy, ich möchte Dir einen Vorschlag machen“, sagte er.“Dieser Marx ist nur ein Mensch, wie Du sagst. Er war fehlbar, wie Menschen sind. Wir Bären übrigens auch. Seine Frau leidet bestimmt noch im Grab darunter, daß sie Seite an Seite mit Lehnchen Demuth modern muß, obwohl das ein Problem ist, das wir promisken Bären nicht nachvollziehen können. Entschuldigung, ich schweife ab. Ich möchte Dir ein Duell vorschlagen. Ein friedliches Duell. Unsere Waffe heißt Karl Marx. Du scheinst ihn ähnlich gut zu kennen wie ich, und Du darfst auch meine mitgebrachte Bibliothek benutzen. Das Ziel ist klar, oder?“
Grizzy hatte zunehmend gespannt zugehört und richtete sich jetzt auf.
„Selbstverständlich. Wenn ein Mensch genug Argumente hat, um Bären davon abzuhalten, die Welt zu vernichten, die die Menschen zugrunde richten, dann hast Du gewonnen.“
Kein Laut war in der Höhle zu vernehmen. Tumu, die unlängst Goethes Faust I‘ gelesen hatte, lief es eiskalt den Rücken herunter. Das war kein Pakt, das war eine Wette, und die gesamte Welt stand dabei zur Disposition. Auch alle anderen fühlten die Anspannung und waren mucksmäuschenstill.
Bärdel schluckte. Am liebsten hätte er Einspruch erhoben, aber er schreckte davor zurück. Bisher hatte Kulle noch immer gewußt, was er tat.
„Kein Einspruch?“ fragte er dennoch hoffnungsvoll, aber niemand rührte sich.“Also dann! Habt Ihr Euch schon geeinigt, wer anfängt?“
Grizzy und Kulle schüttelten gleichzeitig den Kopf, aber Grizzy sagte:“Kulle darf anfangen.“
„Gut!“ Kulle ging zu seinem Karren, zog ein Buch hervor, das ziemlich weit rechts gelegen hatte, schlug es auf und sagte:“Ich zitiere aus der Heiligen Familie‘“.
„Das Privateigentum als Privateigentum, als Reichtum, ist gezwungen, sich selbst und damit seinen Gegensatz, das Proletariat, im Bestehen zu erhalten. Es ist die positive Seite des Gegensatzes, das in sich selbst befriedigte Privateigentum.
Das Proletariat ist umgekehrt als Proletariat gezwungen, sich selbst und damit seinen bedingenden Gegensatz, der es zum Proletariat macht, das Privateigentum, aufzuheben. Es ist die negative Seite des Gegensatzes, seine Unruhe in sich, das aufgelöste und sich auflösende Privateigentum.
Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre eigne Macht und besitzt in ihr den Schein einer menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in der Entfremdung vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichcn Existenz. Sie ist, um einen Ausdruck von Hegel zu gebrauchen, in der Verworfenheit die Empörung über diese Verworfenheit, eine Empörung, zu der sie notwendig durch den Widerspruch ihrer menschlichen Natur mit ihrer Lebenssituation, welche die offenherzige, entschiedene, umfassende Verneinung dieser Natur ist, getrieben wird.
Innerhalb des Gegensatzes ist der Privateigentümer also die konservative, der Proletarier die destruktive Partei. Von jenem geht die Aktion des Erhaltens des Gegensatzes, von diesem die Aktion seiner Vernichtung aus.“
Schon während Kulle las, begannen einige Bären ungeduldig mit den Füßen zu scharren. Auch ließ sich vereinzelt unwilliges Brummen hören. Viele konnten mit dem langen, ihnen unverständlichen Text nichts anfangen.
Aber Kulle bemerkte davon nichts. Befriedigt klappte er den Band zu, sah Grizzy triumphierend an und legte das Buch zurück in den Wagen. Grizzy streckte unbeeindruckt die Hand aus und sagte:
„Ach bitte, bring mir doch auf dem Rückweg MEW 3 mit!“Und dann legte Grizzy los:
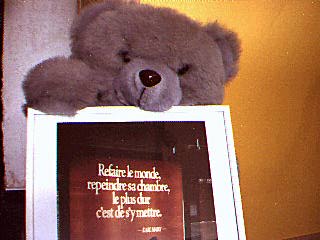
Grizzy klappte das Buch zu, ging die paar Schritte bis zu Kulles Karren und legte es an seinen Platz.
„Jetzt reicht es aber!“ grollten ein paar alte Bären im Chor, und etliche Jungbären, die nicht gewagt hatte, eigenständig Widerstand gegen das ihnen unverständliche Kauderwelsch zu leisten, schlossen sich ihnen begeistert an.
„Wir wollen Märchen hören, nicht so ein komisches abstraktes Zeug!“
„Ruhe!“ forderte Bärdel.“Bären, Ihr alle seid mit dem Zitatenduell einverstanden gewesen, jedenfalls hat keiner Kulles Vorschlag widersprochen. Jetzt müssen wir auch geduldig abwarten, bis die beiden fertig sind.“
Das sahen die Bären ein, wenn auch viele nur widerwillig. Es wurde wieder ruhig in der Höhle, und aller Augen wandten sich Kulle zu. Er war dran.
Aber Kulle winkte nur resigniert ab.
„Laßt nur“, sagte er leise, ohne sich von der Stelle zu rühren.“Es ist vorbei. Grizzy hat gewonnen.“
„Ach ja?“ Es war das erste Mal, daß die alte Bärin sich in eine Höhlendiskussion einmischte, und deshalb wandten sich ihr alle Köpfe zu. Normalerweise pflegte sie zuzuhören und höchstens einmal zustimmend oder ablehnend zu brummen. Tagsüber tat sie ohne viele Worte ihre Arbeit. Es war die Alte, die am Morgen den Dorfplatz gefegt hatte.
„Ach ja?“ wiederholte sie, und ihre Stimme triefte vor Hohn.“Mir reicht es jetzt! Erst arbeiten wir alle tagelang für diesen … diesen Möchtegernbären, völlig umsonst, aber anstatt uns dafür zu entschädigen, mit einer schönen Geschichte zum Beispiel, verdirbt er uns den Abend mit unverdaulichem Zeug. Und Du“ – anklagend zeigte sie auf Kulle -„machst dabei auch noch mit! Jetzt hast Du verloren – das hast Du nun davon! Was Du verloren hast und warum, das hat außer Dir wahrscheinlich keiner begriffen. Ich jedenfalls nicht, und ich will es auch gar nicht mehr wissen. Ich habe Kopfschmerzen, und ich gehe jetzt ins Bett. Wer kommt mit?“
Sie wartete keine Reaktion ab, sondern trabte davon. Die meisten Bären folgten ihr, ebenfalls grußlos. Die Höhle leerte sich. Von vornherein war klar, wer zurückblieb: Bärdel, Tumu, Manfred und Kulle. Und selbstverständlich Grizzy.
„Hm“, machte Bärdel und bemühte sich trotz seiner Aufgewühltheit um Beherrschung.“Bitte entschuldige, Grizzy – normalerweise versuchen wir hier, höflicher miteinander umzugehen. Aber Du mußt zugestehen, daß Du uns heute ziemlich viel zugemutet hast!“
Grizzy zuckte die Schultern.
„Ihr habt mich eingeladen“, sagte er schlicht.
„Genau genommen habe ich Dich eingeladen“, murmelte Kulle. Das stimmte zwar nicht ganz, aber niemand widersprach.
„Jetzt bloß keine wechselseitigen Schuldzuweisungen!“ bestimmte Tumu resolut.“Die bringen uns nicht weiter. Ich bin vielmehr an Aufklärung interessiert. In einem Punkt stimme ich nämlich mit meiner alten brummigen Freunddin überein: Verstanden habe ich Eure Zitate auch nicht.“
Kulle und Grizzy öffneten gleichzeitig den Mund, um zu antworten, aber Manfred kam ihnen zuvor.
„Wenn ich darf, will ich‘s gerne versuchen. Das war zwar alles ziemlich oldfashioned, aber ich glaube, ich hab‘s gerafft.“
Tumu war so verblüfft über diese Aussage, daß sie gar nicht daran dachte, ihren Sohn wegen seines Jargons zu rügen. Auch Bärdel schaute erstaunt, und Kulle und Grizzy klappten ihren Mund wieder zu. So konnte Manfred ungehindert weitersprechen.
„Also, Kulle wollte sagen, daß der ganze Mist mit den Menschen nur daher kommt, daß es Herrschende und Beherrschte gibt. Die Beherrschten sind viel zahlreicher als die Herrschenden, und sie sind mit ihrer Lage unzufrieden. Deshalb werden sie einen Aufstand machen, und danach ist Friede, Freude, Eierkuchen. Grizzy hat gekontert und argumentiert, daß die Menschen nur Frieden halten können, wenn jeder genug zu beißen hat. Sonst stellt sich die ganze alte Scheiße wieder her. Hat mir gut gefallen, der Spruch – den muß ich mir merken. Das war schon die ganze Zitiererei. Aber wenn man das jetzt zusammennimmt mit dem aktuellen Zustand der Welt – sechs Milliarden Menschen, begrenzte Ressourcen, zerstörerische Technologien und der ganze Mist – , dann sieht man, daß nicht alle genug zu beißen haben können. Also hat Kulle verloren.“
Manfred, Tumu und Bärdel schauten Grizzy und Kulle an – Tumu und Bärdel fragend, Manfred Bestätigung suchend.
Ein doppeltes Nicken war die Antwort.
„Gur“, sagte Bärdel schließlich.“Wenn ich das richtig begiffen habe, seid Ihr Euch einig, daß der berühmte point of no return für diese Welt überschritten worden ist. Anders formuliert: Es gibt kein Mittel, um die Erde zu retten. Richtig?“
Grizzy und Kulle nickten, und Manfred schloß sich an.
„Mag sein, daß Ihr recht habt, obwohl mir der Gedanke gar nicht paßt. Wie sagen die Menschen doch? Credo, qia absurdum. Ich glaube zwar nicht, aber ich habe Hoffnung, obwohl und weil es absurd ist. Ohne Hoffnung kann ich nicht leben – und Tumu ebensowenig. Ohne Hoffnung zieht man keine Kinder groß. Entschuldigt, ich schweife ab. Grizzy, wenn Du meinst,daß die Erde, so wie wir sie kennen, von den Menschen ruiniert wird, dann gibt es doch eigentlich keinen Grund dafür, diesen Prozeß zu beschleunigen, oder?“
„Doch, den gibt es. Ich versuche, Schadensbegrenzung zu betreiben. Wenn die Menschen verschwinden, bevor sie auch den letzten Brocken Kohle verfeuert haben, werden die, die nach uns kommen, bessere Chancen haben.“
Zweifelnd wiegte Bärdel den Kopf hin und her.
„Wenn es keine Kohle mehr gibt, kommt bestimmt auch niemand auf die Idee, sie als Energieträger zu nutzen – mit all den Folgen, die wir kennen. Und übrigens: Ist es etwa Schadensbegrenzung, wenn Du der dehländischen Atomindustrie zuarbeitetst und dafür sorgst, daß die Protagonisten des nächsten Evolutionsschubs mit Hunderten von Tonnen Plutonium zurechtkommen müssen? Von dem anderen strahlenden Zeug will ich gar nicht erst reden!“
Grizzy schwieg und sah Bärdel lange an. Dann senkte er den Blick zu Boden und begann ein neues Sandgemälde.
Tumu öffnete den Mund. Es war offensichtlich, daß sie ärgerlich war und gleich eine ihrer gefürchteten Schimpfkanonaden beginnen würde. Aber bevor sie dazu kam, legte Bärdel ihr seine große Pranke aus Gesicht.
„Schsch!“ flüsterte er beruhigend.“Kommt, gehen wir schlafen! Wir sollten Grizzy jetzt in Ruhe lassen.“
Draußen sahen sie einander im spärlichen Licht der Sterne an.
Kulle holte tief und erleichtert Luft.“Das scheint ja noch mal gutgegangen zu sein!“ sagte er.
„Meint Ihr, daß Grizzy jetzt bei uns bleibt?“ fragte Manfred.
„Wenn er möchte, ist er uns willkommen. Wir werden ihn allerdings gut verstecken müssen – auch der dümmste Mensch wird diesen Riesen nicht mit seinesgleichen verwechseln. Jedenfalls ist das meine Meinung“, antwortete Bärdel.“Tumu, was meinst Du?“
Kulle und Manfred hatten den Eindruck, daß Tumu gar nichts meinte, denn sie schwieg. Aber Bärdel spürte, wie sie mit aller Kraft seine Hand drückte. Zärtlich gab er den Druck zurück.
Geschichte

Bärdel lag auf dem Bauch und träumte von Tumu. Das wußte nur er. Er schnarchte leise. Das wußte er nicht, aber Manfred lauschte dem regelmäßigen Schnarchen. Er war geduldig, mehr als eine halbe Stunde lang. Dann hatte er genug. Schließlich war jetzt die Stunde des Denkens, da konnte sein Vater doch nicht einfach pennen!
„Papa!“
Bärdels Brummen klang wie ein sehr uncharmantes Grunzen, aber Manfred ließ sich nicht irritieren. Ganz im Gegenteil.
„Papa!“
Das klang schon wesentlich energischer, aber Manfred hatte kein schlechtes Gewissen. Ein junger Bär kannte sein Recht auf Bildung und nahm es wahr. Der Erfolg gab ihm Recht: Bärdel wurde allmählich wach.
„Hmmm,“ machte er. Zwar klang das noch äußerst unverbindlich, dennoch glaubte Manfred gewonnen zu haben. Also setzte er zum dritten Mal an.
„Papa, woher kommen wir eigentlich?“
„Was für eine bescheuerte Frage!“
Bärdel schickte sich an, sich tiefer in die gemütliche Grasmulde zu kuscheln, die er sich für sein Nickerchen zurechtgewühlt hatte. Dennoch fühlte er sich bemüßigt, seinem Sohn ein Minimum an Antwort zuteil werden zu lassen.
„Vielleicht aus den Karpaten oder den Alpen. Möglicherweise auch aus den Pyrenäen. Höchstwahrscheinlich nicht aus Skandinavien. Ich friere nämlich ziemlich leicht.“
Überlegen schüttelte Manfred den Kopf, was Bärdel zum Glück nicht sah, weil er sein Gesicht wieder im Gras begraben hatte. Die Wanderungsbewegungen des europäischen Braunbären in den letzten Jahrhunderten konnte man in jedem Biologiebuch nachlesen. Diese Werke waren ziemlich korrekt, soweit er das beurteilen konnte. Allerdings wußten sie nicht, daß die bedrohte Spezies, von der einige Exemplare soeben in den Pyrenäen versuchsweise ausgewildert wurden, mitten in Dehland ein verstecktes Refugium gefunden hatte.
„Ich meine die Frage nicht geographisch. Ich meine sie geschichtlich.“
Das wirkte offensichtlich, denn Bärdel setzte sich ruckartig auf.
„Wie meinst du die Frage?“ wollte er wissen.
„Geschichtlich. Ich will wissen, was für eine Geschichte wir Bären haben. Davon ist in den Menschenbüchern nichts zu lesen.“
Jetzt saß Bärdel so kerzengerade, wie ein denkender Bär nur sitzen kann. Lange Zeit schwieg er, und Manfred wartete geduldig. Endlich sagte er:
„Ich glaube, wir haben keine Geschichte.“
Manfred erschrak: „Das ist ja furchtbar!“
Er war so aufgebracht, daß er aufstand und wahllos ein paar Brombeerblüten von ihren Zweigen riß, ohne daran zu denken, daß ihm die Früchte in ein paar Wochen fehlen würden.
Bärdel dagegen blieb ganz ruhig.
„Warum ist das furchtbar?“
„Weil ich in allen Geschichtsbüchern der Menschen gelesen habe, daß man aus der Geschichte lernen soll. Aber wenn du Recht hast und wir keine Geschichte haben, dann können wir ja nichts lernen!“
Wie häufig bei schwierigen Diskussionen wünschte Bärdel sich Kulle herbei, aber der war nun mal nicht da, und er sagte sich: Selbst ist der Bär!
Er griff sich zwei Fallkirschen, die die Stare nur leicht malträtiert hatten, bot Manfred eine an und fragte scheinbar leichthin: „Was ist eigentlich Geschichte?“
So einfach ließ Manfred sich nicht einschüchtern.
„Geschichte“, sagte er so selbstverständlich, als hätte er die Definition selbst gefunden, „Geschichte ist das, was in Raum und Zeit geschehen ist, beziehungsweise die Erinnerung daran in mündlicher oder schriftlicher Form. Geschichte bezieht sich auf Gesellschaften, benennt ihre wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und geistigen Veränderungen.“
„Eine hervorragende Definition!“
Bärdel war mit seinem Sohn zufrieden und bot ihm eine weitere Kirsche an.
„Aber du hast mir Recht gegeben. Die Bärengesellschaft hat keine Veränderungen erlebt, soweit wir uns erinnern können. Unsere Vorfahren in den Karpaten oder den Pyrenäen hatten ihre Sippe genau wie wir, ernährten sich ähnlich, trafen sich abends, um zu spielen oder sich Märchen zu erzählen, in der Höhle, und hielten Winterschlaf. Insofern haben wir aus der Geschichte gelernt, ohne eine Geschichte zu haben – wir machen alles genau wie unsere Vorfahren.“
Unzufrieden schüttelte Manfred den Kopf.
„Aber was meinen dann die Menschen damit, wenn sie dauernd fordern, aus der Geschichte zu lernen?“
Weitere Kirschen waren nicht in Sicht, also beschloß Bärdel, daß sein Sohn die nächste Lektion ohne Versüßung schlucken mußte. Es tat ihm leid, denn das, was er zu sagen hatte, war besonders bitter.
„Worin besteht die Geschichte der Menschen?“ Er ließ Manfred keine Zeit zur Antwort, sondern sprach sofort weiter. „Aus gewonnener oder verlorener Macht, nichts weiter. Wenn Menschen also aus der Geschichte lernen wollen“ – er betonte jetzt jedes Wort – „dann wollen sie nichts anderes, als sich mit Hilfe historischer positiver oder negativer Vorbilder gute Vorbedingungen für ihre eigene Machtstellung schaffen.“
Darüber mußte Manfred eine Weile nachdenken. Er kannte sich relativ gut in der Menschengeschichte aus. Cäsar stürzt die römische res publica, Chlodwig schwingt sich zum fränkischen König auf, Henri IV. findet, daß Paris eine Messe wert ist, Ludwig XVI. wird geköpft, das Direktorium köpft Robespierre, Napoleon Bonaparte entmachtet das Direktorium … und so weiter, und so fort. Sein Vater schien Recht zu haben, aber er wehrte sich.
„Politisch – na gut. Aber was ist mit der Entwicklung der Schrift, der Literatur, der Malerei?
Jetzt wünschte sich Bärdel brennend weitere Kirschen herbei, um Manfred das Folgende wenigstens etwas zu versüßen. Aber es gab nun mal keine.
„Die Schrift war nach der Religion das zweite effektive Herrschaftsinstrument der Menschen – genutzt für Verwaltung und Kontrolle. Literatur – na ja. Entweder haben die gerade Herrschenden sie in ihren Dienst gestellt, oder die Schriftsteller wurden toleriert, eben weil sie Schriftsteller waren. Wer schreibt, wirft keine Bomben. Aufsässige Dichter haben außerdem aus Sicht der Herrschenden angenehme Eigenschaften: Sie sterben früh, begehen Selbstmord oder werden, wenn das nicht klappt, verrückt – denk an Büchner, Kleist oder Hölderlin. Was wolltest du noch? Malerei? Die Kunst geht nach Brot – Malerei in der Menschheitsgeschichte ist überwiegend schmeichelnde Hofmalerei. Und wenn das jemand nicht mitgemacht hat, wie zum Beispiel Vincent van Gogh, dann konnte er sich halt ein Ohr abschneiden, ohne daß ein Hahn danach gekräht hat.“
Das reichte erstmal, fand Bärdel.
„Gut“, sagte Manfred. „Oder auch nicht gut. Die Menschen lernen nichts aus ihrer Geschichte, weil sie nur Schlechtes lernen, wenn überhaupt etwas, und wir Bären können nichts aus unserer Geschichte lernen, weil wir im Sinn der Geschichtsdefinition keine haben. Folgerichtig ist meine Ausgangsfrage unsinnig. Richtig?“
„Richtig!“ bestätigte Bärdel. Er hoffte, jetzt weiterdösen zu können, aber da er seinen Sohn kannte, fragte er vorsichtshalber noch einmal nach.
„Hast du sonst noch Fragen?“
Manfred nickte.
„Ja, Papa. Wohin gehen wir?“
Irritiert schüttelte Bärdel den Kopf.
„Was soll das denn nun?“
„Papa“, erklärte Manfred geduldig, „seit ich denken kann, sind wir in Bärenleben nicht allein. Wir haben mit den Menschen zu tun. Wir lernen von ihnen, wir tricksen sie aus. Wir benutzen ihr Wissen, ihre Bücher. All das tun wir, um weiter in Bärenleben existieren zu können. In gewisser Weise kämpfen wir also auch um die Macht. Wir sind in die Geschichte eingetreten. Ist es nicht so?“
„Oh Gott“, sagte Bärdel, aber er verbesserte sich sofort: „Oh Tussi!“
Dann vergrub er sich in sein Grasbett. Ein mitleidiger Star, der keine Ahnung von Geschichte hatte, ließ eine Kirsche neben seinem Kopf niederpurzeln, und Bärdel griff dankbar blind danach und aß sie auf.
Jobsuche
Nach sechs Stunden Marsch konnte Manfred allmählich erleichtert durch Dehland wandern. Tumus Tränen, als sie ihn ziehenlassen mußte, Tränen, die er schließlich mitgeweint hatte, waren vergessen. Die tagelangen Diskussionen mit Bärdel beschäftigten ihn allerdings immer noch.
„Du willst dir einen Job suchen? Bei den Menschen? Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen“?
Manfred war standhaft geblieben. Schließlich hatte er gute Argumente: Auch seinem Vater war es schon gelungen, sich gegenüber Menschen als Mensch auszugeben (vergleiche Außergewöhnliches Beispiel von Menschenliebe bei einem wilden Tiere), warum also sollte er enttarnt werden? Und: Wenn man etwas über Menschen lernen wollte und es unabdingbar für das eigene Überleben war, möglichst viel über sie zu wissen – welche besseren Lehrer könnte man finden als die Menschen selbst? Er hatte Bärdel sogar dazu bewegen können, ihm zu allen möglichen Zeugnissen zu verhelfen. Aus der Bärenfälscherwerkstatt trug er Dokumente über Abschlüsse dehländischer Schulen und Hochschulen und angebliche Bescheinigungen real existierender Firmen mit sich, die ihm bestätigten, ein hervorragender Mitarbeiter gewesen zu sein, den man mit Bedauern hatte gehen lassen. Da Menschen das Alter von Bären, die sich als Menschen ausgeben, überhaupt nicht einschätzen können, konnte er mit diesen Unterlagen nach Belieben spielen.
Ob das wirklich richtig ist, was ich mache? fragte er sich. Aber natürlich gab er sich die richtige Antwort: Ein Mann geht seinen Weg! Und das, obwohl Manfred noch nie einen Western gesehen hatte…
Er hatte keine genaue Vorstellung davon, wie er sein Ziel erreichen sollte. Auch wußte er nicht, ob es geschickter war, sein Glück in einem Dorf, einer Klein- oder Großstadt zu versuchen. So ging er einfach geradeaus – im dicht besiedelten Dehland würde er schon bald über irgend etwas stolpern und dann entscheiden.
Er stolperte bald. Als er von einem Waldweg aus eine Straße und an deren Rand ein Ortsschild wahrnahm, das Lehrte“ ankündigte, zog er aus seinem Rucksack – den er als vierfüßiger Bärenwanderer als Bauchsack getragen hatte – Hemd, Hose und Jacke und zog sie an. Danach schulterte er sein Gepäckstück und richtete sich auf. Zum Abschied pflückte er eine Himbeere, ie ihn verführerisch rot anblinzelte, und nahm mit ihr vorerst Abschied von seinem Bärendasein.
Lehrte, entdeckte er bald, war eine Kleinstadt. Stellenangebote, nach denen er Aussschau hielt, gab es nicht. Aber damit hatte er gerechnet. Er wußte, daß Menschen Jobs in der Zeitung fanden – oder beim Arbeitsamt.
Also ging er in ein Papierwarengeschäft. Auf einer Bank im nahen Park schlug er die Zeitung auf, die er erworben hatte: die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Wochenendausgabe. Er ging die Stellenanzeigen durch.
Erst jetzt fiel ihm auf, daß er sich bisher nur wenig konkrete Vorstellungen gemacht hatte. Er wollte bei den Menschen arbeiten — nun gut. Aber was? Was war besonders gut geeignet, um sie kennenzulernen? Die Zeitung verwirrte ihn nur – Stellenanzeigen allgemein, Außendienst, Kaufmännisches, Gewerbliches, medizinisch-soziale Berufe. Diese Klassifizierung führte wohl nicht weiter. Also stellte er sich die wichtigste Frage überhaupt: Was macht mir Spaß? Unter diesem Gesichtspunkt fand eine Annonce sein Interesse: Eine Versicherungsgesellschaft suchte einen Executive Assistent für die Abteilung Versicherungsmathematik. Voraussetzungen für den Job waren eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (die hatte er, sagten seine Zeugnisse), ein gutes Zahlenverständnis (rechnen konnte er) und körperliche Einsatzbereitschaft (Als junger Bär liebte Manfred es zu raufen, wenn er auch nicht so recht verstand, wieso diese Vorliebe in einem menschlichen Beruf gefragt war.). Das Problem war: Man wollte von ihm wissen, welche Gehaltsvorstellungen er hatte. Also: Bist du billiger als die anderen Bewerber, hast du gewonnen. Oder doch nicht? Vielleicht bedeutete ein Billigangebot ja auch: Ich bin schlecht? Und was war überhaupt bei den Menschen in Dehland gegenwärtig billig, was teuer? Ob Bärdel das gewußt hätte? Jedenfalls hatte er ihn nicht gefragt…
Er las weiter. Anderen Jobangeboten entnahm er, daß sich die Bezahlung bei den Menschen häufig an BAT orientierte. Was das wohl sein mochte? Bären- Arbeits-Tarif? Unwahrscheinlich…
Neben seiner Parkbank stand eine Telefonzelle, und ordentlich, wie es in Dehland nun einmal war, hing das örtliche Telefonbuch neben dem Apparat. Manfred schlug es auf und suchte : BAT – nicht vorhanden. Wahllos blätterte er weiter – schließlich hatte er noch nie ein menschliches Telefonbuch gesehen. Von einem bärischen ganz zu schweigen – Bären hatten kein Telefon, sie redeten noch wirklich miteinander. Bei O stolperte er über Ordnungsamt. Ein für die Ordnung zuständiges Amt müßte doch eigentlich ordentlich erklären können, was Unverständliches bedeutete. Er wählte die Nummer.
Tuut,tuut,tuut, didadidadidadidadah, dadadah, dadadah, bitte warten, didadidadidadidadah, dadadah, dadadah, bitte warten…
„Ordnungsamt Hannover“!
„Guten Tag. Ich wollte Sie nur um eine Auskunft bitten. Was, bitte, bedeutet BAT“?
„Eine solche Auskunft gehört eigentlich nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Ich sage es Ihnen trotzdem: Bundesangestelltentarif“.
„Und wie hoch ist der? Ich meine, wieviel Geld verdient man da“?
„Zu wenig, guter Mann, viel zu wenig. Ich werde nach BAT bezahlt, ich weiß, wovon ich rede“.
„Ja – aber – entschuldigen Sie: Was heißt denn das konkret“?
„Sie dürften selbst wissen, daß man über Geld nicht redet. Wenn Sie einen Paß oder Personalausweis beantragen wollen, stehen wir Ihnen gerne in der Zeit von…“
Manfred legte auf. Er war so schlau wie vorher, aber eine Auskunft, die ihm weiterhalf, würde er hier nicht bekommen. Also gut – dann galt es eben zu pokern.
Er rief die Versicherungsgesellschaft an und vereinbarte einen Gesprächstermin für den nächsten Tag.
Das aber bedeutete, daß er für die Nacht eine Unterkunft brauchte. Nächtigen in Lehrte? Zwar war das Leben in diesem Nest für einen Bären schon wahrhaft aufregend, aber wenn er jetzt die Gelegenheit hatte, wollte er möglichst viel kennenlernen. Er stapfte zum Bahnhof und kaufte sich eine Fahrkarte ins nahe Hannover.
Als er dort aus dem Zug hüpfte, machte er einen Fehler: Er wandte sich Richtung Raschplatz.
Für einen Bären, der an gegenseitige Rücksichtnahme und wechselseitige Hilfestellung in allen Lebenslagen gewöhnt ist, ist eine menschliche Großstadt, in der sich keiner um den anderen kümmert, auch wenn es dem noch so schlecht geht, ein Schock. Das ist schon schlimm genug, wenn er an Orte gerät, an denen es den meisten Menschen gutgeht.
Der Raschplatz war kein solcher Ort. Manfred bediente sich der üblichen Mechanismen intelligenter Lebewesen, die versuchen, einen überwältigenden Eindruck zu verarbeiten: Er bemühte sich, Worte für seine Wahrnehmung zu finden. Er mußte lange suchen, obwohl er über einen großen Wortschatz verfügte. Schließlich kamen ihm fünf Buchstaben in den Sinn, die er auf einer Wanderung durch den Harz auf einem Ortsschild gesehen hatte: Elend. Elend – das paßte. Das quäkende Lautgebilde beschrieb Dreck, zerstochene und zerschundene Haut, Orientierungslosigkeit und Gestank. Alles war überlagert von einem noch penetranteren Geruch, dem der Gleichgültigkeit.
Von Panik ergriffen, kehrte er um und ergriff das Bärenpanier. Kaum ein Passant wunderte sich darüber, daß ein etwa menschengroßes Wesen halb aufrecht, halb auf allen Vieren erst durch die Bahnhofs- und dann durch die Karmarschstraße hetzte. Als er das geschafft hatte, verlangsamte Manfred sein Tempo: erstens ging ihm allmählich die Puste aus, und zweitens gab es nach zehn Minuten wilder Jagd keine Menschen mehr, die ihn verunsicherten. Er war im Maschpark angekommen. Langsam trottete er über die gewundenen Pfade, kreuzte noch eine Straße und legte sich dann zwischen Rosenrabatten auf die Bärenhaut. Hier war kein Mensch. Er spürte, daß auch keiner kommen und ihn stören würde.
Sein Bäreninstinkt hatte ihn richtig geleitet: Welcher Hannoveraner geht schon auf den 1945 angelegten Friedhof der von den Nazis ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen? Die meisten wissen noch nicht einmal, daß es ihn gibt…
Ausgeschlafen sprang er ein paar Stunden später am frühen Morgen in den Maschsee. Nach dem Bad, bei dem er einem ausführlichen philosophischen Disput der Seekarpfen lauschte, von dem er nur wenig verstand, war es allmählich Zeit, sich zur Versicherung aufzumachen. Auf dem Weg dorthin schüttelte Manfred hin und wieder immer noch den Kopf: Was diese Fische umtrieb! Richtig beredsam wurden sie bei der Frage, ob die Hannoveraner es wert seien, zu Weihnachten und Silvester von ihnen gefüttert zu werden. Anstatt sich auf die universellen Tierrechte zu berufen und sich jedem Gefressenwerden zu verweigern!
Wenig später saß er auf einem niedrigen Stuhl einem großen Schreibtisch gegenüber, hinter dem in einem hohen Sessel eine Menschenfrau thronte. Sie hatte sich ihm als Sabine Schreiner vorgestellt. An der Tür, durch die sie ihn gerade geführt hatte, hing ein Schild, das Personalbüro besagte. Jetzt redete sie, ohne dabei etwas zu sagen. Manfred kannte diese Art der Nichtmitteilung, diesen Fluß von Leerformeln und höflichen Lügen, und es war ihm trotz höchster Konzentration nicht möglich, inhaltlich zu folgen. Das war kein Nachteil. Wichtig war allein, im entscheidenden Moment richtig zu reagieren. Also konzentrierte er sich nur auf den Augenblick, in dem sie ihre Stimme am Ende eines Satzes hob.
„Das hat mich schon immer interessiert“, antwortete er auf ihre Frage. „Sehen Sie, es gibt Dinge, bei denen die Menschen Hilfe benötigen. Ich denke, ich könnte da von Nutzen sein“.
In Bärenleben hatte Manfred bei Kulle nämlich einmal einen Rhetorikkurs belegt. Was er gerade reproduziert hatte, war Kulles Patentantwort Nummer Eins, passend für alle Situationen: Sie war angemessen als Reaktion auf die Behauptung, daß die Welt von Gott verlassen sei, ebenso wie auf die Feststellung, daß die Arbeitslosenzahlen ständig stiegen. Selbst als Reaktion auf eine Liebeserklärung konnte sie, ein wenig modifiziert, zur Not durchgehen.
Manfred hatte auch gelernt, daß eine derartige Aussage zwar gut ankam, aber sofort eine Frage provozierte. Wollte man der entkommen, mußte man selbst eine Frage stellen. Natürlich war Manfred ein gelehriger Schüler gewesen, also fuhr er ohne Pause fort:
„Was erwarten Sie von mir?“
Statt einer direkten Antwort legte sie ihm einen Schriftsatz vor.
„Machen Sie sich damit in aller Ruhe vertraut. Ich lasse Ihnen einen Kaffee kommen und lasse Sie allein. In einer halben Stunde bin ich wieder da“.
Kaffee – das mußte wohl sein. Mitleidig sah Manfred den Ficus Benjamini an, der die braune Brühe würde schlucken müssen. Bären und Kaffee – das vertrug sich einfach nicht miteinander.
„Danke“, sagte er höflich und schlug den Ordner auf.
Den Fall durchschaute er schnell. Der Studienrat Michael Strauß hatte im Alter von 40 Jahren eine private Zusatz-Rentenversicherung abgeschlossen und 25 Jahre lang regelmäßig seine Beiträge gezahlt. Der letzte Zahlungseingang lag zwei Jahre zurück. Strauß war jetzt 67 und erhielt seit seiner Pensionierung seine Privatrente.
Ein klarer Fall ohne irgendwelche Probleme. Manfred schüttelte den Kopf. Er verstand nicht im Geringsten, was solche klaren, eigentlich abgeschlossenen Fälle mit Versicherungsmathematik und körperlicher Einsatzfähigkeit zu tun hatten.
Als Sabine Schreiner zurückkam, schenkte sie ihm neben einem charmanten Lächeln ein erwartungsvolles: „Nun, Herr Bär“?
Manfred pokerte – auch das hatte er von Kulle gelernt . und hob die Schulter. „Ganz klare Sache, keine Frage“.
„Hervorragend“! Frau Schreiner war sichtlich erleichtert. „Ich hatte gleich den Eindruck, daß Sie für derlei verantwortungsvolle Aufgaben geeignet sind. Die Zusammenarbeit mit unserer Gesellschaft wird Sie nicht reuen. Wir zahlen gut – 1000 DM Prämie pro Fall, zuzüglich Spesen. Erfahrungsgemäß bearbeiten unsere Mitarbeiter zwischen acht und fünfzehn Fälle pro Monat“.
Also acht- bis fünfzehntausend Mark im Monat, rechnete Manfred blitzschnell. Das war sehr viel Geld, soviel immerhin wußte er. Merkwürdig – jetzt machte sie ihm ein Angebot, aber in der Anzeige hatte gestanden, daß er Forderungen stellen sollte. Er ging darüber hinweg.
„Ich denke, das kann ich auch leisten“.
Manfred legte alle ihm zur Verfügung stehende Seriosität in seine Stimme. Er verriet Sabine Schreiner nicht, daß er noch immer nicht wußte, was er in seiner neuen Stellung zu tun haben würde. Trotzdem – oder gerade deshalb – bekam er den Job. In drei Tagen sollte er anfangen. Zur Einarbeitung, wie Sabine Schreiner sagte, drückte sie ihm ein Köfferchen voller Papiere in die Hand.
Dank ihrer Vermittlung fand er auch eine kleine Wohnung. Schade eigentlich – er hatte sich auf dem sowjetischen Friedhof und bei den Karpfen sehr wohl gefühlt. Für Menschen brauchte er aber künftig wohl eine menschliche Adresse. Das Wichtigste im Augenblick jedoch war, daß er einen Vorschuß erhielt.
Manfred verschwendete keine Zeit damit, sich Möbel anzuschaffen. Er gab sein Geld für Fahrscheine für die Stadtbahn aus und ließ sich zur Universität kutschieren.
Ich glaub, ich bin in England, brummelte Manfred vor sich hin, als er auf das Tudorschloß zusteuerte, in dem Hannovers Universität beheimatet war. Aber dann kümmerte er sich nicht mehr um Architektur, sondern fragte sich zum Immatrikulationsamt durch und schrieb sich ein: Manfred Bär, Volkswirtschaftslehre.
Als er wieder in seiner Wohnung war, schaute er sich zunächst den Inhalt von Sabine Schreiners Geschenk an. Der Aktenkoffer seiner neuen Firma war prall gefüllt mit Papieren. Fünfzehn Personalakten stapelten sich darin, alle von ähnlicher Qualität wie die des Studienrates Michael Strauß. Daneben lag eine in Folie eingeschweißte Tabelle. Über den zahlreichen Spalten standen merkwürdige Überschriften: Geb.-Jr., Verf.-Jr. oder Neg.-Zeitr. fanden sich da.
Manfred verstand, daß er nichts verstand. Aber das beunruhigte ihn nicht. Er hatte die Bärenruhe weg, und noch hatte er zwei Tage Zeit. Der Student Manfred Bär würde schon herausbekommen, was hier gespielt wurde.
Früh am nächsten Morgen verschwand er im Lesesaal der Universitätsbibliothek. Er entschwand buchstäblich allen Blicken, denn bald türmten sich auf dem Tisch vor ihm meterhohe Bücherstapel.
Zuerst widmete er sich dem Band Empfehlenswerte Abkürzungen im Versicherungswesen, herausgegeben von E. N. T. Täusch, und ließ sich darüber belehren, daß Geb.-Jr. Geburtsjahr hieß. Verf-Jr. bedeutete Verfallsjahr, und Neg-Zeitr. war der Negativzeitraum. Empfehlenswert, so der Herausgeber im Vorwort, seien diese Abkürzungen vor allem deshalb, weil sich der Versicherungsnehmer in den wenigsten Fällen unter ihnen etwas vorstellen könne. Manfred stimmte aus vollem Herzen zu – auch den Volltext verstand er nur zum Teil.
So kam er also wohl nicht weiter. Es galt, die Angelegenheit grundsätzlich anzugehen. Grundlagen des Versicherungswesens. Eine Einführung – Prof. Dr. R. Eibach würde ihm mit seinem dicken Wälzer weiterhelfen, hoffte er.
Manfred lernte, daß eine Versicherung auf die planmäßige und entgeltliche Deckung eines risikogerechten Eventualbedarfs abzielt, also Schäden, die nach Anzahl, Zeitpunkt und Höhe unbestimmt sind, deckt. Eintritt und Höhe der Bedarfsfälle, so Prof. Eibach, ließen sich um so sicherer berechnen, je größer die Zahl der zu einer Gefahrengemeinschaft vereinigten Einheiten sei.
Den zweiten Gedanken verstand Manfred. Tumu hatte ihn gründlich in die Wahrscheinlichkeitsrechnung eingeführt – alle jungen Bären lernten das, und als Material benutzten sie mit Vorliebe Brombeeren. Mit dem ersten Satz aber hatte er Schwierigkeiten: Wieso deckte eine Versicherung nur Schäden? Der Studienrat Strauß hatte doch keinen Schaden erlitten, sondern freute sich über sein Rentnerdasein! Aber dann dämmerte es ihm: Was Michael Strauß freute, war in den Augen der Versicherung ein Schaden. Strauß kostete Geld.
Entsetzen durchschoß ihn: Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen bekamen die Worte Verfallsjahr und Negativzeitraum plötzlich eine Bedeutung. Für einen kurzen Moment durchzuckte ihn eine Idee, was sein neuer Arbeitgeber wirklich von ihm wollte. Aber dieser Gedanke erschien ihm so absurd, daß er ihn sofort aus seinem Kopf verbannte.
Dennoch – plötzlich war ihm übel. Hastig verließ er den Lesesaal und suchte frische Luft.
Also: Vermutlich hatte seine Versicherung Probleme mit ihren privaten Altersversicherungen. Das Verfallsjahr schien das Jahr zu sein, von dem ab der Rentner mehr Geld als Rente bekam, als er vorher als Prämie eingezahlt hatte. Von diesem Jahr ab begann für die Versicherung der Negativzeitraum. Natürlich kamen solche Fälle immer mal vor, aber sie sollten theoretisch ausgeglichen werden – durch diejenigen, die so früh starben, daß sie die von ihnen angesparte Summe nicht mehr in Anspruch nehmen konnten. Mathematische Stochastik – das Gesetz der großen Zahl. Und versicherungsmathematisch, überlegte Manfred sich, war die Prämie natürlich so kalkuliert, daß bei einer berechenbaren Zahl von kurz- und langlebigen Versicherten noch genug Geld in der Firma hängenblieb…
Entweder reichte seiner Versicherung der Normalprofit nicht mehr, so daß sie ihre Versicherten vor deren natürlichem Ende loswerden wollte, oder sie hatte sich verrechnet.
Manfred wurde bewußt, daß er jetzt schon ganz selbstverständlich von der Hypothese ausging, daß er als Mörder gedungen werden sollte. Seine sonst so kräftigen Bärenbeine sackten unter ihm weg, er mußte sich setzen. Jetzt wußte er, warum sein Vater ihn hatte überzeugen wollen dazubleiben, warum seine Mutter so viele Tränen geweint hatte. Das Denken der Menschen war mörderisch (Die Menschen selbst nennen das in Verkennung ihrer Natur inhuman) , und es färbte ab. Er begann zu weinen.
„Natürlich guckt wieder kein Schwein“, hörte er plötzlich neben sich eine laute Stimme. „Ein Bär hockt heulend an einem Baum mitten im hannoverschen Georgengarten, dazu noch direkt neben dem Wilhelm-Busch-Museum, und keiner nimmt‘s zur Kenntnis“!
Manfred war kein verklemmter Menschenmann, er fand es also ganz natürlich zu weinen, wenn er traurig oder verzweifelt war. Trotzdem war es ihm peinlich, in aufgelöstem Zustand von einem wildfremden Wesen ertappt worden zu sein. Er wischte sich die Augen, murmelte etwas von Heuschnupfen und wandte dann seinen Kopf zur Seite.
„Du bist ein Schwein!“ entfuhr es ihm.
„Na klar“, grunzte sein Gegenüber, keineswegs beleidigt.
Rosa Haut, Steckdosenschnauze, spitze Ohren, Ringelschwänzchen: Es war zweifellos ein Schwein.
„Wieso sagst Du dann, daß Du nicht guckst? Du siehst mich doch an“!
„Ich habe nur zitiert. Und außerdem bin ich eine Karikatur. Mir ist übrigens kalt, ich gehe wieder rein. Zu Hause bin ich da drüben im Museum. Komm doch mit“.
Manfred in seinem Bärenpelz fror es zwar nicht, aber er fühlte sich trotzdem kalt – von innen heraus. Er rappelte sich auf und folgte dem Schwein ins Haus. Wilhelm-Busch-Museum stand daran und Karikaturenmuseum.
Innen gab es einen Kassenschalter, und Manfred langte nach seiner Geldbörse. Der Kassierer aber grinste nur.
„Lassen Sie das, Sie Kunstfigur! schmunzelte er. Ab in Ihren Rahmen!“
Achselzuckend schlenderte Manfred weiter in die Ausstellung. Die Waechter des Museums begrüßten ihn wie einen alten Bekannten. Außerdem begrüßte ihn das Ausstellungsmotto: Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland.
Gestern noch hatte Manfred geschwankt, ob er sich an der Uni für VWL oder für Politik einschreiben sollte. Heute stellte er fest, daß seine Entscheidung richtig gewesen war. Ein Mini-Politikstudium konnte er hier im Museum absolvieren. Einführung in Soziologie und Psychologie inklusive.
Er schlenderte herum und bildete sich. Der Kanzler war eine Birne. Kernobst als Kopf einer Gesellschaft? Das sprach nicht gerade für die Wähler…
Auf einer anderen Zeichnung versetzte ein Hund zahlreichen Katzen, die sich noch nicht einmal durch Fauchen zur Wehr setzten, Schwere Bisse und jagte sie aus dem Haus. Die Bildunterschrift belehrte ihn, daß ein Mensch namens Hundt Arbeitgeberpräsident war.
Die dritte Karikatur, die seine Aufmerksamkeit auf sich zog, zeigte zwei Männer. Ein Gesicht, dessen Hauptcharakteristik eine große Nase war, neigte sich über ein anderes. Untengesicht hatte eine Sprechblase, in der stand: Herr Kultusminister, das ist zu viel! Obengesicht antwortete: Kein Grund zur Aufregung, Herr Studienrat! Wir haben Ihre Dienstpflichten so kalkuliert, daß Sie sie bis zu ihrer Pensionierung gerade noch werden erfüllen können.

Das also war des Studienrats Michael Strauß Kern! Der war nicht als Mensch zu alt, sondern als Studienrat! Die Versicherung hatte sein Alter auf der Basis seiner Berufszugehörigkeit kalkuliert, und er hatte es gewagt, nicht gleichzeitig mit seiner Pensionierung zu sterben, sondern zwei Jahre weiterzuleben. Dementsprechend war er für die Versicherung ein Schaden geworden.
Für Manfred war jetzt glasklar, was von einem Executive Assistent der Abteilung Versicherungsmathematik erwartet wurde. Er sollte als Mörder arbeiten, um die fehlerhaften Hypothesen der Versicherungsgesellschaft wieder ins Lot zu bringen.
Was sollte er tun?
Manfred zog sich in eine stille Ecke des Museums zurück und erprobte seine Muskeln. Er ging auf die Toilette, stellte sich vor den Spiegel und zeigte sich selbst seine fürchterlichsten Grimassen. Lautlos übte er dazu seine Kampfschreie.
Dann gab er es auf.
Seine Situation war ihm klargeworden.
Natürlich war es eine verführerische Idee, in Sabine Schreiners Büro zu marschieren, ihr seine Verachtung ins Gesicht zu schmettern und ihr zu erklären, daß er ihre Mordpläne durchschaut hatte. Und dann? Sie würde die Polizei rufen, die die Feuerwehr, und schließlich würde er als die Allgemeinheit gefährdender Bär im Zoo landen – wenn er Glück hatte. Wahrscheinlich würde er als tollwütiges Tier eingeschläfert werden. Einschläfern – so nannten das die Menschen.
Sich mit den Tieren verbünden, zum Beispiel mit dem Schwein? Wenig aussichtsreich – die Tiere schienen damit glücklich zu sein, als Karikaturen existieren zu dürfen.
Es gab nur eins – zurück nach Bärenleben.
Manfred ließ alles stehen und liegen. Zum Glück wußte er, welche Richtung er einschlagen mußte, um nach Hause zu kommen – zu Tumu, zu Bärdel und zu Kulle und all den anderen. Er dachte nicht an das Geld, das er hatte. Er dachte nicht an Verkehrsmittel. Er rannte einfach. Er übersah sogar die Beeren am Wegesrand. Er aß nicht. Er trank nicht. Er rannte. Dann torkelte er. Er wankte vorwärts. Zuletzt kroch er. Er kämpfte um jeden Zentimeter, der ihn Bärenleben näher brachte. Tumu fand ihn schließlich – wer auch sonst? Er hatte es fast geschafft.
„Manfred“!
Unruhig wälzte er sich auf seinem Laublager hin und her.
„Manfred“! Sanft legte sie ihre Tatze auf seine Schulter.
Er zuckte zusammen. Sein Körper rollte sich weg.
Sie griff fester zu. Er wand sich.
„Manfred! Wach auf“!
Bilder: Sabine Schreiner hält ihn fest, eine Statistik in der Hand, die besagt, daß er zu alt ist, sterben muß…
„Manfred! Du bist zu Hause“!
Der Widerstand schwand. Er wachte auf. Er öffnete die Augen und sah Tumu. Er lächelte.
„Mama.“
Tumu brauchte nach dieser anstrengenden Wiederbelebung noch viel Kraft, um Manfred wieder zu einem normalen Jungbären zu machen. Er wollte kaum etwas essen, und es war ihre Rettung, daß sie sich an einige alte Rezepte von Mama Gorilla erinnern konnte (vergleiche die Rezepte in „Grimmis Buch vom Gorillasee“), an denen er Gefallen fand und die ihn schließlich wieder zu Kräften brachten.
Als Manfred wieder aufrecht hocken konnte, bat er darum, den Stammesrat einzuberufen. Tumu sorgte für genügend Platz in der Wohnhöhle, so daß alle gemütlich sitzen konnten. Es war Herbst geworden, draußen pfiff ein starker Wind, und alle Angehörigen der Bärensippe kuschelten sich aneinander.
„Freunde“, sagte Bärdel. „Mein Sohn hat um diese Versammlung gebeten. Ich weiß, daß er Schweres erlebt hat. Ich weiß nicht, was er uns sagen will. Ich bitte, hört ihn freundlich an“.
Bärdel sagte die Wahrheit – und doch nicht. Natürlich hatte er von Tumu einiges darüber erfahren, was Manfred bei den Menschen durchgemacht hatte. Dennoch tat er pflichtgemäß so, als sei er uninformiert – so hatte sich ein objektiver Versammlungsleiter bei den Bären zu verhalten. Gleichzeitig mußte er immer um freundliches Gehör bitten – das gehörte auch zum Ritual.
Zustimmendes Gemurmel antwortete ihm.
„Ich“, sagte Manfred, „habe Unsinn gemacht. Meine Eltern haben mich gewarnt. Ich habe ihnen zuwider gehandelt und bin zu den Menschen gegangen. Ich bin gegangen, weil ich etwas über die Menschen lernen wollte. Ich habe auch etwas gelernt: Menschen rechnen Menschen gegen Geld auf. Wenn es ihnen zu teuer wird, bringen sie die zu teuren Menschen um. Sie heuern sogar Mörder an, um solche angeblich zu teuren Menschen zu töten. Sie haben versucht, mich als einen solchen Mörder anzustellen“.
Stille herrschte in der Bärenhöhle. Unsicher schaute Manfred von einem Gesicht zum anderen. Alle waren ihm zugewandt. Alle lächelten ihm zu.
„Was ist?“ fragte er.
Das Lächeln verstärkte sich.
„Was ist?“
Er sah in die Runde, sah Kulle an. Es war ihm unmöglich, die Beherrschung und Zurückhaltung zu wahren, die in einer Bärenversammlung zum guten Ton gehören.
„Bei Tussi! brach es aus ihm heraus. Glotzt nicht so verständnislos! Es geht um Mord, sogar um Massenmord! Dagegen muß man doch etwas tun!“
Unsanft wies Bärdel ihn zurecht – bei aller Sympathie durfte ein Versammlungsleiter einen solchen Ausfall nicht durchgehen lassen.
Kulle meldete sich zu Wort: „Die negative Weiterentwicklung der Primaten zu den Humanen und die damit einhergehende ethische Regression hat logisch eine Extension der Agression zur Folge, gerade auch intra speciem. Das ist wissenschaftlich unumstritten. Es ist daher…“
Zufällig streifte sein Blick beim Sprechen Manfred, der ihn mit offenem Mund verständnislos anstarrte. Am liebsten hätte er sich vor Ärger eine Pranke voll Haare aus dem Pelz gezogen. Mußte er auch gerade jetzt in seinen alten Fehler verfallen! Immer dann, wenn er gerührt war, drückte er sich viel zu hochgestochen aus. Sofort schaltete er um:
„Es ist daher völlig verständlich, wenn Manfred einen Schock erlitten hat“. „Auch“, fuhr er fort, indem er sich Manfred direkt zuwandte, „auch kann ich gut verstehen, daß Du gegen das Morden etwas unternehmen möchtest. Das geht aber nicht. Hör mir jetzt gut zu: Die Menschen machen das, weil sie Menschen sind. Verstehst Du? Weil! Sie handeln nicht gegen ihre Natur, sondern ihr entsprechend. Wenn Du den Massenmord beenden willst, mußt Du die Menschen vernichten“.
Lastendes Schweigen füllte die Höhle. Langsam setzte sich Kulle.
Erst nach langer Zeit war wieder ein Geräusch zu hören. Manfred räusperte sich die Kehle frei.
„Entschuldigung“ sagte er. „Das wußte ich nicht. Ich habe geglaubt…“. Hilflos brach er ab.
„Alle jungen Bären glauben das“, brummte Bärdel. „Weil sie Bären sind“.
„Aber warum… Warum habt Ihr…?“
„Warum wir Dich haben ziehen lassen? Leicht ist es uns nicht gefallen, das hast Du gemerkt. Die meisten jungen Bären müssen die Menschen direkt kennenlernen. Sonst wissen sie nicht, wie diese Monstren wirklich sind. Die Erzählungen von uns Alten haltet Ihr Jungen für übertrieben.“
„Stimmt“, seufzte Manfred. „Ich habe Euch nie so richtig geglaubt. Aber jetzt habe ich Angst. Sollte man nicht Bärenleben…?“
„Keine Sorge“, schmunzelte Bärdel. „Während Deiner Abwesenheit haben unsere Physiker die Tarnkappe über Bärenleben fertiggestellt. Uns findet keiner – zumindest kein Mensch.“
Plötzlich ertönte vor der Höhle lautes Rülpsen und Grunzen. Höhnisch schien es Bärdel zu widerlegen. Die Bären hockten starr. Ein Kopf schob sich herein: Steckdosenschnauze, spitze Ohren, Ringelschwänzchen.
„Ich bitte um politisches Asyl“, quiekte es.
„Gewährt“, brummte die Bärenhorde im Chor.
Kulle über Sex
PD Kulle
Die menschliche Sexualität im Zeitalter ihrer nicht nur natürlichen, sondern auch technischen Reproduzierbarkeit (1)

- Sexualität bei Pflanzen, Tieren und Menschen
- Die quantitative Entwicklung der Menschheit
- Die menschliche Anpassungsfähigkeit
- Die Nicht-Adaptionsfähigkeit der menschlichen Sexualität
- Der Korrekturversuch der Natur und seine Konterkarierung
- Künstliche Insemination
- Genetische Manipulation
- Fazit
- Fazit des Fazits
- Nachwort
Menschen können erstaunlicherweise manche Sachverhalte relativ angemessen rational beschreiben, obwohl sie sich in actu unangemessen irrational verhalten. Diese interessante Diskrepanz erlaubt es, zur Definition des zu untersuchenden Gegenstandes vorläufig auf Meyers Lexikon (2) zurückzugreifen.
Sexualität, so lesen wir da, „ist bei Pflanzen und Tieren identisch mit der geschlechtlichen Fortpflanzung. Bei niederen Tieren (3) ist das Fortpflanzungsverhalten allein von Geschlechtshormonen gesteuert, artspezifisch stereotyp und ausschließlich heterosexuell. Bei höheren Arten (4) übernimmt die Großhirnsteuerung eine stetig zunehmende Rolle. Die Folgen sind sexuelle Aktivität vor Eintritt der Geschlechtsreife und außerhalb der Brunst, Selbstbefriedigung, Homosexualität und die Bevorzugung bestimmter Partner.
Die Sexualität des Menschen schließlich geht noch weit (5) über das hinaus, was mit der Lust und den Aktivitäten in Abhängigkeit vom Funktionieren der Geschlechtsorgane sowie mit dem Verhalten, das zur Befruchtung…führen kann, zusammenhängt.“ (6)
Schon nach dieser kurzen Definition läßt sich also feststellen, daß menschliche Sexualität in zwei Richtungen strebt, die teilidentisch, aber auch völlig diskrepant sein können:
- Fortpflanzung
- sexuelle und/oder psychische Befriedigung.
Den wichtigsten Aspekt allerdings deutet Meyers Lexikon bestenfalls an:
Die menschliche Sexualität ist in all ihren Emanationen maßlos.
Betrachten wir zunächst die Fortpflanzung.
Allein die absoluten Zahlen sprechen für sich.
Im Jahr 7000 v. Chr. (7) betrug die menschliche Weltbevölkerung ca. 10 Millionen.(8) Im Jahr 4500 v. Chr. waren es 20 Millionen. Homo sapiens sapiens brauchte also 2500 Jahre, um sich zahlenmäßig zu verdoppeln – ein Verhalten, das schon nicht mehr als weise bezeichnet werden kann. Schließlich beträgt die Landmasse der Erde 149 Millionen km2, das ergibt rein rechnerisch pro Mensch im Jahr 4500 v. Chr. etwa 7,5 km2. Die Fläche reichte also bereits nicht mehr für jeden aus, um sich als Jäger und Sammler durchzuschlagen, wenn man die Unwirtlichkeit von Sand- und Eiswüsten berücksichtigt. Allein die Jäger- und Sammlerexistenz wird jedoch jener Notwendigkeit gerecht, die seit einigen Jahren unter dem Schlagwort „sustainable development“ auch ansatzweise ins menschliche Bewußtsein dringt, obwohl die Menschen unter diesem Slogan natürlich die Entwicklung zu retten versuchen, also den Kapitalismus, nicht aber ihren Lebensraum.
Wie aber ging es weiter? Ich kürze die Darstellung ab: 1950 betrug die menschliche Weltbevölkerung 2,5 Milliarden, 1986 lebten 5 Milliarden Menschen auf der Erde. Die Menschen brauchten also nur noch 36 Jahre, um ihre Zahl zu verdoppeln, und jedem Menschen standen 1986 statistisch 0,03 km2 zur Verfügung.
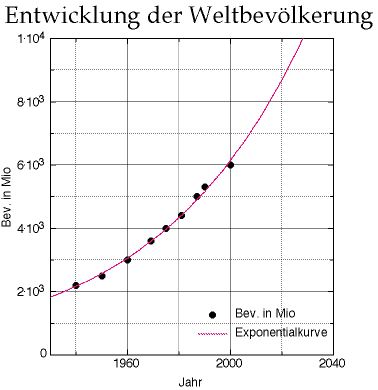
Es gilt, eine Populationszunahme in einem Zeitrahmen von – grob gerechnet – 6500 Jahren zu analysieren, die 25 000% beträgt. Selbst zahlreiche Seuchen, Hungersnöte und etliche Selbstausrottungsversuche der Menschen – sie selbst nennen das Kriege – konnten daran nichts ändern.
25 000%! Eine ungeheure Zahl! Selbst eine Krebszelle wäre stolz, wenn sie um so viel wachsen könnte. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte sie ihren Wirtskörper vorher zerstört.
Wie haben die Menschen das geschafft?
Zwar ist die Frage sekundär9 , dennoch soll sie zuerst beantwortet werden.
Der Schlüssel zur Lösung des Rätsels liegt in der verblüffenden intermediären (10) Adaptionsfähigkeit der Gattung Homo sapiens sapiens. Nach der Existenzphase als Jäger und Sammler konnten die Menschen durch die Ausweitung des Lebensraumes der Gattung, durch Ackerbau und Viehzucht, durch die Nutzung regenerativer und fossiler Energien ihren Ressourcenoutput erhöhen und gleichzeitig den individuell benötigten Lebensraum begrenzen. Die zunächst recht langsame zahlenmäßige Zunahme der Menschheit war dem mangelnden Wissen in bezug auf Hygiene und Gesundheit geschuldet, was eine hohe Mortalitätsrate vor allem bei jungen menschlichen Individuen zur Folge hatte. Erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts beschleunigte sich das Wachstum der Gattung, denn bessere Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten verringerten die früher letalen Folgen lokaler Katastrophen. Das ausgehende 19. und das frühe 20. Jahrhundert dann sind gekennzeichnet durch bahnbrechende Erkenntnisse der Medizin, dank deren (11) die Mortalitätsrate signifikant sank. Nach dem II. Weltkrieg (12) erreichten die Prinzipien einer öffentlichen Gesundheitspflege und besserer hygienischer Bedingungen auch Asien, Lateinamerika und – zum Teil – Afrika, und Lebensmittel aus den von den Menschen so genannten entwickelten Ländern wurden dorthin exportiert (13), ohne die in diesen Regionen hohe Fertilitätsrate zu reduzieren.
Die Ursache dieses bemerkenswert raschen Wandels in der gesellschaftlichen Organisation des Gattungslebens liegt in dem, was die Menschen Intelligenz nennen (14) . Mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln haben sie sich als Art angepaßt, wobei der Verlust an Individuen bei einem Wandel immer hoch war. (15)
Die eigentlich entscheidende Frage lautet aber:
Warum (16) haben die Menschen das geschafft?
Der Schlüssel zur exorbitanten Quantitätszunahme von Homo sapiens sapiens liegt in der menschlichen Sexualität. Nein, falsch! Ich korrigiere mich wie folgt: in der männlichen menschlichen Sexualität. Ganz richtig ist das auch nicht: Das Wachstum hat auch mit der weiblichen Fertilität zu tun.
Wenn ich, P. D. (17) Kulle, zu stottern anfange, muß es sich um ein wirklich schwieriges Problem handeln. Es ist so, in der Tat. Ich werde versuchen, es am Beispiel der Kaninchen zu erläutern.(18)

In Zeiten hoher sexueller Aktivität, wenn das Weibchen empfängnisfähig ist, vulgo Rammelzeit genannt, rammelt das Kaninchen-männchen. Das Rammeln unterscheidet es im Prinzip nicht vom Menschenmännchen (19) . Allerdings ist für dieses, anders als für das Kaninchen, immer Rammelzeit. Menschenfrauen sind nämlich im Prinzip (20) immer zur Paarung bereit, auch wenn sie nur in einem Zyklus von durchschnittlich 28 Tagen empfängnisfähig sind. Tiere dagegen verkehren nur sexuell miteinander, wenn das Weibchen empfangen kann. Ein Kaninchenmann (21) muß sich von Oktober bis Februar anderweitig vergnügen.
Nehmen wir an, die Kaninchenfrau wird schwanger, und auch die Menschenfrau wird schwanger. Beide Schwangerschaften verlaufen gut. Die Menschenfrau bringt ein Kind zur Welt, einen Jungen oder ein Mädchen – völlig normal für Menschenfrauen. Auch die Kaninchenfrau bekommt Kinder, aber deren Zahl richtet sich nach den jeweiligen Umweltbedingungen. Bis zu 30 Jungkaninchen pro Jahr sind biologisch möglich. War der Winter jedoch hart, gibt es also wenig zu knabbern, bleibt der Wurf klein. Sind die Bedingungen besser, kommen mehr Junge zur Welt. Aber auch die Zahl der Jagdfeinde ist bei guten Bedingungen höher, so daß die große Zahl rasch dezimiert wird.
Zwischenbilanz: Die globale Kaninchenpopulation (22) ist zwar kurzfristigen Schwankungen unterworden, sie bleibt aber wegen der in natürliche Vorgänge eingebundenen Lebensweise der Spezies letztlich konstant.
Über ein solches Anpassungsverhalten verfügen die Menschen nicht. Im Gegenteil: Ihr Sexualverhalten zeigt, daß sie sich um so intensiver reproduzieren, je schlechter die individuellen Rahmenbedingungen für die Aufzucht des Nachwuchses sind. Da Jagdfeinde der menschlichen Rasse fehlen (23) , ist auch ein Korrektiv dieses Verhaltens ex post nicht möglich.
Folgerung: Menschliche – männliche wie weibliche – Sexualität ignoriert Umwelt-(24) bedingungen völlig.
Bei der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen entsprechend dem Stand der von ihnen entwickelten Produktivkräfte nicht nur von ihrem Willen unabhängige Produktionsverhältnisse ein (25) , es entstehen auch Konsumtionsverhältnisse.
Die angesichts der großen Menschenzahl notwendige Industrialisierung der Agrarwirtschaft und der Lebensmittelproduktion kann und will aus Profitinteresse auf die permanente und zunehmende Induzierung chemischer Substanzen nicht verzichten. Eben diese Industrialisierung und der damit einhergehende Abusus von Boden, Wasser und Luft wirken negativ nicht nur auf die menschliche Gesundheit im allgemeinen, sondern speziell auch auf die Spermaproduktion des Menschenmännchens. Gelten 200 – 300 Millionen Spermien pro Ejakulation als biologisch normal, so läßt sich seit Jahrzehnten eine Abnahme der Samenzellen beobachten, die inzwischen zu signifikanten Unfruchtbarkeitsquoten geführt hat.
Ist also endlich auch mit der Abnahme dieser Spezies zu rechnen, die sich, wir erinnern uns, effektiver vermehrt als eine Krebszelle? (26)
Weit gefehlt!
a) Künstliche Insemination
Dem egoistischen Individualsinn der Menschen, der sich hervorragend mit dem Sinn für Profit ergänzt, ist es geschuldet, daß der natürliche Rückgang der Fruchtbarkeit der menschlichen Spezies konterkariert werden konnte. (27) Menschenfrauen, die unfähig waren, Kinder zur Welt zu bringen, behaupteten, entsetzlich zu leiden (28) . Um diesem entsetzlichen Leiden zu entgehen, waren und sind sie bereit, sich entsetzlichem Leiden auszusetzen. So unterziehen sie sich zum Beispiel der Prozedur der in-vitro-Fertilisation: Sie lassen sich eine Eizelle aus der Gebärmutter entnehmen, die dann im Reagenzglas die Chance bekommt, sich mit Spermien zu vereinigen – möglicherweise Spermien des eigenen Mannes, aber, sollte der unfruchtbar sein, auch mit anderen. Parallel dazu existiert die in-vivo-Befruchtung: Die Menschenfrau erlaubt während ihrer fruchtbaren Tage einer kalten sterilen Kanüle statt eines warmen pulsierenden Penis, sich ihrer Gebärmutter zu nähern und dort ihren Samen zu deponieren.
Es ist nicht nur diese Tortur, die jedes fühlende Wesen schaudern macht, sondern auch ihr Ergebnis: Anders als bei der normalen Befruchtung endet das Rennen der Spermien oft unentschieden, mehrere erreichen gleichzeitig ihr Ziel, die Eizelle, und durchdringen deren Trennwand. Das Ergebnis sind Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, Fünflinge – Mehrlinge. Die Menschheit vermehrt sich so in einem Maße, das alle bisherigen Horrorszenarien (29) verblassen läßt.
Damit nicht genug!
b) Genetische Manipulation
Seit nunmehr fünfzig Jahren bemühen sich die Menschen, das geheimste Geheimnis der Natur zu entschlüsseln: Das Genom, das Erbgut. Sie haben inzwischen gelernt, viele der in der DNA verschlüsselten Informationen zu lesen und zu verstehen. Sie können sie auch kopieren und manipulieren, so daß sie die Natur von Pflanzen und Tieren (30) verändern.
Das öffentliche Interesse der Menschen wird gegenwärtig aber nicht von dieser sehr weitgehenden Perspektive beherrscht, sondern von einem Schlagwort, das viel kürzer greift: Kloning. Kloning, das Herstellen von Klonen, meint die Reproduktion biologisch identischer Lebewesen. Die Idee scheint faszinierend (31) , und manche meiner menschlichen Wissenschaftlerkollegen (32) und auch sogenannte normale Menschen (33) sind davon schier besessen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich den bärischen klaren Verstand aber schnell der entscheidende Pferdefuß: Psyche, Wissen und Erfahrung sind nicht übertragbar.
Fassen wir zusammen.
Der Mensch ist das Krebsgeschwür dieser Welt. Er verhält sich wie eine Krebszelle. Wäre er intelligent genug, um zu begreifen, welche Gefahr er darstellt, würde er seine Reproduktion drastisch einschränken. Offenbar ist er dazu nicht intelligent genug, da es ihm an Möglichkeits- und Zukunftssinn mangelt. Im Gegenteil: Die partiellen intellektuellen Fähigkeiten, mit denen er ausgestattet ist, benutzt er, um sich weiter zu vermehren und sein eigenes Gattungsleben um so schneller zu beenden, während er doch glaubt, es zu verlängern.
Pfffffffffffft…(34)
- Selbstverständlich weiß inzwischen jeder, daß ich meiner Sekretärin danke.
- Ich danke den Menschen, bei denen ich immer dann wohne, wenn ich nicht in Bärenleben bin, dafür, daß sie keine Kinder haben.
- Ich hasse alle Menschen, die mehr als zwei Kinder haben, die sich in vitro oder in vivo fertilisieren oder sich klonen lassen.
Fußnoten:
1 Ich entschuldige mich bei Walter Benjamin für das Plagiat ![]()
2 vgl. Meyers großes Taschenlexikon in 24 Bänden, Mannheim 1997, Schw – Spin ![]()
3 Ich will hier nicht erörtern, wer damit gemeint sein könnte. Meiner Erfahrung nach gehören Frösche auf jeden Fall nicht dazu .![]()
4 Dankbar nehme ich zur Kenntnis, daß die biologische Systematik der Menschen Bären dazurechnet. ![]()
5 Was „weit“ bedeutet, wird zu untersuchen sein .![]()
6 ebd. Deutlich wird hier übrigens die Sichtweise, daß Menschen weder Pflanzen noch Tiere sind. Als Wissenschaftler kann ich diesen Unsinn nicht gutheißen, als voreingenommener Bär stimme ich hingegen zu – ich möchte mit den Menschen so wenig wie möglich zu tun haben. ![]()
7 Ich bediene mich hier der gängigen sog. abendländischen Zeitrechnung, obwohl jeder Wissenschaftler weiß, daß diese äußerst fragwürdig ist .![]()
8 Zwar war ich selbst damals noch nicht geboren und kann dergleichen Angaben also nicht empirisch nachprüfen; auch weiß ich nicht, auf welche Erkenntnisse meine menschlichen Wissenschaftlerkollegen ihre Aussagen stützen. Der Einfachheit halber glaube ich ihnen ausnahmsweise mal. ![]()
9 Die Begründung für diese Einschätzung folgt weiter unten. ![]()
10 Auch dieses wertende Adjektiv wird später erläutert .![]()
11 besser: derentwegen ![]()
12 Nach menschlicher Zählung, versteht sich: Die Pflanzen und wir Tiere haben noch nie auch nur einen Krieg geführ t. ![]()
13 Natürlich nur die Überschüsse! ![]()
14 „Intelligenz“ impliziert nach menschlicher Definition die Fähigkeit, Wissen zur Bewältigung neuer, akuter Probleme anzuwenden und so bisher unbekannte Situationen bewältigen zu können. Der uns Bären beständig gegenwärtige Möglichkeits- und Zukunftssinn spielt dabei allerdings keine Rolle. ![]()
15 Ich könnte hier übrigens viel darüber erzählen, wie viele andere Gattungen durch die Ausbreitung von Homo sapiens sapiens vernichtet worden sind oder durch sie gelitten haben. Eigentlich habe ich Lust dazu, denn ich bin ein Bär. Aber ich bin auch ein wissenschaftlicher Bär, und als solcher sage ich: Das gehört nicht hierher. ![]()
16 vgl. Anmerkung 9 ![]()
17 vgl. „Der Wert“ ![]()
18 Man möge mir zugute halten, daß ich nicht, wie die menschlichen Biologielehrer, auf die Bienen zurückgreife. ![]()
19 Im Prinzip nicht, die bei Menschenmännchen beobachtete Phantasie ist allerdings bei einigen wenigen Exemplaren höher ausgeprägt. ![]()
20 Vergewaltigungen müssen bei dem hier zu erörternden Problem leider unberücksichtigt bleiben. ![]()
21 Die Rede ist hier nur von ordentlichen Wildkaninchen, nicht von unordentlichen Haustieren. ![]()
22 „Bevölkerungsexplosionen“ auf so genannten neu entdeckten Kontinenten wie Amerika oder Australien bleiben hier aus evidenten Gründen unberücksichtigt .![]()
23 vgl. Anmerkung 15 ![]()
24 Ich benutze diesen Begriff lediglich, damit menschliche Leser mich verstehen. Selbstverständlich wäre es viel korrekter, von „Welt-“ zu sprechen .![]()
25 Ich entschuldige mich ebenfalls bei Karl Marx .![]()
26 Die Menschheit ist übrigens auf dem Weg, ihren Wirtskörper zu zerstören, beeindruckend weit vorangekommen. Dieses an sich positive Phänomen hat allerdings eine Kehrseite: Der Wirtskörper der Menschen ist auch der aller anderen Existenzen .![]()
27 Das Modalverb gibt selbstverständlich die menschliche Sicht der Entwicklung wieder. ![]()
28 Ich als Bär maße mir nicht an, dieses Leiden zu beurteilen. Allerdings gebe ich zu, daß es mir schwer fällt, ein heimliches Kichern zu verbergen .![]()
29 Ich verweise hier z. B. auf den vielleicht auh Menschen bekannten Spielfilm: „2024 – die überleben wollen“ .![]()
30 Da Menschen, wissenschaftlich betrachtet, Tiere sind, können die Menschen natürlich auch in ihre eigene biologische Struktur eingreifen – und sie tun das auch. Allerdings geben sie das bisher öffentlich nicht zu. Entsprechende Arbeit wird in höchst geheimen Labors geleistet .![]()
31 Ich muß leider zugeben, daß auch ich selbst eine Sekunde lang von der Idee fasziniert war, mich verdoppelt zu sehen .![]()
32 Dr. Seed aus den USA z. B. will sich unbedingt klonen – ob da der Name das Bewußtsein bestimmt ?![]()
33 Die Zahl der Witwen, die sich einen Klon ihres Mannes wünschen, oder der unglücklichen Mütter, die auf diese Art der Reproduktion ihr totes Kind zurückhaben möchten, ist Legion .![]()
34 Ich gebe zu, daß ich überrascht davon bin, daß eine ökonomische und eine biologische wissenschaftliche Arbeit zu demselben Ergebnis führen! ![]()
Grizzys Plan
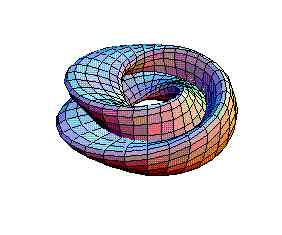
Wer steckt hinter „Murphy’s Law“? Wer sorgt dafür, daß immer alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann?
Grizzy, geheimnisvoller als seinerzeit Markus Wolf, hat sich bereit erklärt, unserer „Zeitschrift“ ein Interview zu gewähren.
Zeitschrift:
Grizzy, wer sind Sie und wo leben Sie?
Grizzy:
Wie mein Name schon andeutet, bin ich ein Grizzly. Im Sommer lebe ich in Grönland und im Winter in Kanada. Ich habe ein wenig Eisbärenblut in den Adern, deshalb liebe ich es kalt.
Zeitschrift:
Sie reisen sonst nicht?
Grizzy:
Doch, natürlich. Anderenfalls könnte ich mein Ziel wohl kaum erreichen. Allerdings ist das manchmal sehr unangenehm, vor allem wenn ich gezwungen bin, tropische Gegenden aufzusuchen. Sehen Sie sich doch mein Fell an – gegen meinen genetisch bedingten Winterpelz bin ich nun mal machtlos. Vor fünf Jahren in Rio habe ich echt gelitten. Alle halbe Stunde habe ich beim Zimmerservice einen Seesack voll Eis bestellt. Allerdings hat sich die Mühe gelohnt, wenigstens aus meiner Sicht. In Denver und New York vor ein paar Tagen war es dagegen sehr viel angenehmer. In Colorado hatte ich sogar Gelegenheit, nebenbei einen alten Bekannten zu treffen.
Zeitschrift:
Grizzy, Sie haben gerade Ihr Ziel erwähnt. Über dieses Ziel rätselt die ganze Welt. Wir alle kennen Sie nur als den geheimnisvollen Bären, der bei vielen internationalen Konferenzen erscheint. Offenbar verfügen Sie über Geld, denn Sie steigen nur in den besten Hotels ab. In der Regel sagen Sie kein Wort, niemand hat je beobachtet, daß Sie mit einem Konferenzteilnehmer ins Gespräch gekommen sind. Und irgendwann sind Sie wieder verschwunden.
Grizzy:
Stimmt.
Zeitschrft:
Also?
Grizzy:
Was also?
Zeitschrift:
Wir fragen Sie jetzt nicht, woher Sie das Geld haben…
…diese Frage würde ich Ihnen auch nicht beantworten…(1)
Zeitschrift:
…sondern was Ihr Ziel ist. Was treibt Sie zu diesen Konferenzen?
Grizzy:
Die Sorge um die Welt. Um es kurz zu machen: Ich sorge für den Erfolg.
Zeitschrift:
Gestatten Sie, daß wir lachen. Vor fünf Jahren in Rio wurde die Agenda 21 unterzeichnet, wurden Absichtserklärungen bekundet. Es gab quasi-verpflichtende Erklärungen wichtiger Industrieländer. Und was ist passiert? Seit Rio gibt es 380 Millionen Menschen mehr, jetzt 5,85 Miliarden. 1,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu gutem Trinkwasser. Der Frischwasserverbrauch steigt schneller als das Wachstum der Weltbevölkerung. 1992 gab es 15 Millionen Flüchtlinge, heute sind es 26 Millionen. 1992 betrug die CO 2-Konzentration in der Luft 356 ppm, heute sind es 364 ppm. Der Waldverlust im Amazonasgebiet ist seit Rio von 11 000 Quadratkilometern im Jahr auf 15 000 gestiegen. Vor fünf Jahren gab es dreizehn Megastädte, heute mindestens 18 – sollen wir noch weitermachen?
Grizzy:
Gerne, wenn Sie möchten.
Zeitschrift:
Aber das kann Ihnen doch keinen Spaß machen?
Grizzy:
Warum nicht? Jeder hört schließlich gerne seine Erfolgsbilanz.
(Jeder Reporter wird natürlich vehement leugnen, daß es Momente gibt, in denen es ihm die Sprache verschlägt, aber hier war der Fall gegeben. Erst nach einer langen Pause kam die nächste Frage.)
Zeitschrift:
Sie wollen damit sagen..?
Grizzy:
Ich will damit sagen, daß ich auf diesen internationalen Konferenzen alles tue, um zu verhindern, daß sie Erfolg haben. Ja.
Zeitschrift:
Warum?
Grizzy:
Weil alle diese Konferenzen eine unausgesprochene Prämisse haben: Sie sind von anthropozentrischem Denken bestimmt. Das ist kein Vorwurf per se. Wenn Sie so wollen, denke ich ursozentrisch – also bärisch. Die bärische Philosophie hat aber immer gewußt, daß alles auf der Welt eine Lebensberechtigung hat, daß also nichts zerstört werden darf, auch nicht um des eigenen Vorteils willen. Bärische Erkenntnis sagt, daß die Beeren nachwachsen und die Lachse, die wir schlagen, uns verzeihen werden, denn sie haben gelaicht und sind todgeweiht.
Menschen denken anders. Zumindest die Menschen, die das Schicksal der Menschheit bestimmen. Das geschieht offenbar, wie ich gelernt habe, auf internationalen Konferenzen.
Zeitschrift:
Und wie denken diese Menschen?
Grizzy:
Ich habe gewisse Probleme, das zu begreifen. Velleicht können Sie mir helfen. Eine wichtige Rolle scheint Geld zu spielen. Ich habe zwar Geld, ich bezahle damit meine Hotelzimmer, aber ich weiß nicht, was es den Menschen bedeutet.
Zeitschrift:
Alles.
Grizzy:
Alles? Beeren, Lachse, Wasser, Wälder, Meere…?
Zeitschrift:
In gewisser Weise schon. Alles hat seinen Preis.
Grizzy:
Damit haben Sie recht. Trotzdem muß nicht alles Geld kosten. Aber lassen wir das.
Natürlich weiß ich, daß Sie Ihre Gesellschaft als Tauschgesellschaft organisiert haben und alsTauschmittel Geld benutzen. An sich schon schlimm genug – wer kein Geld hat, kann in der modernen Menschenwelt nicht leben. Ich begreife aber nicht, warum die Mächtigen der Menschen alles daran setzen, mehr Geld zu besitzen, als sie jemals werden ausgeben können.
Zeitschrift:
Das dürfte in einem gewissen Sicherheitsbedürfnis begründet sein.
Grizzy:
Sicherheitsbedürfnis?
Zeitschrift:
Nun ja – Vorbeugung. Zum Beispiel vor Inflation, Kriegs- oder Katastrophenfolgen.
Grizzy:
Dagegen hilft Geld? Menschen denken also, bei einer Inflation werden sie ihre wertlosen Geldscheine kochen und verspeisen, im Krieg ihre Verletzten mit Dollarnoten verpflastern und die Opfer einer Flutkatastrophe auf Flößen aus Yenbündeln bergen?
Zeitschrift:
Verzeihung, Grizzy, aber das sehen Sie wohl doch etwas zu banal. Wir sollten wohl wieder zu unserem eigentlichem Thema zurückkommen: Ihrer Anwesenheit auf wichtigen Konferenzen und Ihrem Erfolgsrezept. Ganz direkt: Warum nehmen Sie an hochkarätigen internationalen Treffen teil?
Grizzy:
Aus Sicherheitsbedürfnis.
Zeitschrift:
Das verstehen wir nicht.
Grizzy:
Dann lassen Sie mich Ihnen helfen. Welches ist das Ziel solcher Konferenzen, zum Beispiel der 1992 in Rio?
Zeitschrift:
Das Überleben zu gewährleisten, selbstverständlich. Sustainable development…
Grizzy:
Wessen Überleben?
Zeitschrift:
Natürlich das der Menschheit.
Grizzy:
Danke.
Zeitschrift:
Wieso?
Grizzy:
Ich bin ein Bär.
Zeitschrift:
Oh.
(Pause)
Aber wir alle wissen doch, daß das Überleben der Menschheit…
Grizzy:
…ohne das Überleben der Bären undenkbar ist! Nicht wahr, das wollten Sie doch sagen? Soll ich Ihnen jetzt wirklich eine Vorlesung über den Umgang von Menschen mit Bären halten? Sie dürften ebenso wie ich wissen, daß das eine Geschichte grausamer Ausrottung ist, weil die Menschen in ihrem überbordenden Fortpflanzungsdrang uns unseren Lebensraum mehr und mehr streitig machten. Falls Ihre Gattung tatsächlich glaubt, meiner Gattung möglicherweise noch einmal zu bedürfen, wird sie unsere wichtigsten Erbinformationen in Genbanken konservieren – das war’s aber auch.
Zeitschrift:
Wollen Sie damit andeuten…?
Grizzy:
Andeuten wollte ich eigentlich gar nichts. Ich wollte laut und deutlich folgendes sagen: Die bisherige Geschichte der Menschheit zeigt, daß zwischen Bären und ihr eine friedliche Koexistenz nicht möglich ist. Folglich muß eine der beiden Spezies verschwinden. Ich versuche zu erreichen, daß das nicht die Bären sind. Also ist jedes Scheitern einer Konferenz, die zum Ziel hatte, die Anwesenheit der Gattung Homo sapiens sapiens auf diesem Planeten zu verlängern, für mich ein Erfolg. Rio, Denver und New York haben gezeigt, daß Ihr primäres Ziel darin besteht, sich zu Tode zu verdienen. Ich arbeite daran, daß Sie dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Zeitschrift:
Ganz leuchtet uns das nicht ein. Wenn Sie daran arbeiten, daß wir uns weiterhin schrankenlos vermehren und diesen Planeten ruinieren, arbeiten Sie doch auch an Ihrem eigenen Untergang?
Grizzy:
In gewisser Weise: ja. Sie werden mich als Individuum, vielleicht auch uns Grizzlys vernichten. Aber wir haben viele kleine Verwandte. Zur Not fangen wir bei den Ratten wieder an. Uns alle werden Sie nicht schaffen.
Zeitschrift:
Grizzy, wir wollen nicht mißtrauisch sein. Sie behaupten tatsächlich, all das zu erreichen, indem Sie einfach nur da sind?
Grizzy:
Haben Sie eigentlich Angst vor mir?
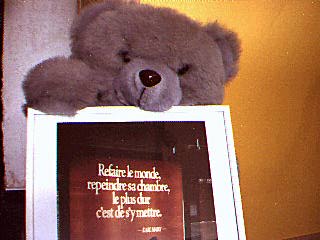
Zeitschrift:
Wir geben es zu: ein bißchen schon. Sie sind groß, haben eindrucksvolle Zähne und Tatzen und duften nicht gerade nach Aftershave…
Grizzy:
Sehen Sie. Mehr brauche ich doch gar nicht. Ich verbreite Wildnisgeruch – und schon werden die Menschen nervös. Ich signalisiere ihnen: Noch haben sie sich die Erde nicht ganz untertan gemacht. Also arbeiten sie weiter daran – wie sie es verstehen…
(1) Wer wissen will, wo das Geld vielleicht herkommen könnte, der schaue hier! (Zurück)
Hamburg und Doris
Hamburg und Doris

Bärdel verschluckte sich vor Überraschung; er kaute gerade genüßlich eine Honigwabe aus. Wieso zog es seinen Sohn in eine Menschengroßstadt? Und vor allem: Warum wollte sein halbstarker Sohn, der beständig nichts mehr betonte als seine Selbständigkeit, auf einmal seine Eltern bei einer so aufregenden Unternehmung dabeihaben?
Nachdem er seinen Husten besiegt hatte, schaute er Manfred nur an, und der verstand die stumme Frage. Er tat sich allerdings schwer, sie zu beantworten, und druckste herum:
„Na ja, ich muß die Menschen doch auch mal kennenlernen, wenn es schon so viele von ihnen gibt. Das geht in einer Stadt bestimmt am besten. Aber ein bißchen Angst habe ich, ehrlich gesagt, doch. Deshalb sollt ihr mitkommen. Und ich möchte etwas Bestimmtes sehen. In der Zeitung habe ich letztens gelesen, daß es in Hamburg einen Zoo gibt. Da möchte ich hin.“
Bärdel simulierte einen neuen Hustenanfall, um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Hamburg? Na gut. Das konnte dem Jungen nicht schaden – erst Jungfernstieg und Binnenalster zum Staunen, vielleicht sogar Blankenese, und danach St. Georg zur Ernüchterung. Falls sie nicht allzu müde waren, auch noch die Reeperbahn. Aber Hagenbecks Tierpark? Niemals!
„Keine schlechte Idee, Manfred!“ sagte er. „Frag mal Mama, wann sie Zeit und Lust hat.“
Bärdel war ein kluger Vater. Er wußte, daß sein Sohn seinen Willen durchsetzen würde, wenn er versuchte, ihm sein Vorhaben zu verbieten. Er mußte also taktieren.
Als Manfred und seine Eltern ein paar Tage später aufbrachen, war Tumu in Bärdels Plan eingeweiht. Castornixleben in der Nähe von Bärenleben hatte einen Bahnhof, und dort schmuggelten sie sich als blinde Passagiere in den Gepäckwagen eines Zuges, der zum Hamburger Hauptbahnhof fuhr.
Manfred war schrecklich aufgeregt: Er war noch nie Eisenbahn gefahren, schon gar nicht ohne zu zahlen, und verstand auch nicht den Grund für ihr illegales Handeln. „Papa, wir haben doch Geld, oder?“
Bärdel nickte und bemerkte nur: „Richtig, aber das brauchen wir für Wichtigeres“, was seinen Sohn auch nicht schlauer machte.
Die Ankunft in Hamburg Hauptbahnhof verwirrte ihn völlig: Zahllose hastende, drängelnde, schimpfende, lachende, bettelnde,weinende, immer aber rücksichtslose Menschen schubsten und stießen einander oder gingen achtlos aneinander vorbei, und dieses Gewimmel überlagerten scheppernde Lautsprecheransagen.
Manfred tat, was er schon lange nicht mehr getan hatte: Er schmiegte sich schutzsuchend an Tumu. „Mama, ich will hier weg!“
„Ich auch!“ seufzte Tumu aus Herzensgrund. „Sag uns schnell, wo der Zoo ist, zu dem du willst. Dort ist es bestimmt ruhiger.“
„Aber ich weiß doch gar nicht, wie man da hinkommt… Vielleicht sollten wir einfach loslaufen und suchen?“
„Keine gute Idee!“ kritisierte Bärdel. „Hamburg ist riesengroß; wir würden uns nur die Füße wundlaufen und nichts finden. Wahrscheinlich müssen wir sogar nochmal mit der Bahn fahren. Kommt, da vorne ist eine Srteckennetzkarte.“
Manfred hatte keine Ahnung, was eine „Streckennetzkarte“ sein könnte, und als er davor stand, wurde er auch nicht schlau daraus. Verschiedenfarbige Linien zogen sich, von wenigen Zentren ausgehend, kurvig über ein überwiegend rechteckiges Grundmuster.
„Na, wohin müssen wir?“ fragte Bärdel. Niemand, noch nicht einmal Tumu, vermochte die gespielte Unschuld in seiner Stimme zu hören.
„Keine Ahnung…“ Manfred zuckte die Schultern. „Erstens verstehe ich diesen Plan nicht. Und zweitens weiß ich noch nicht einmal, wie der Zoo heißt.“
„ich auch nicht“, log Bärdel. „Aber laß uns mal nachdenken. Ein Zoo ist was für‘s Volk. Und ein anderes Wort für ,Zoo‘ ist ,Tierpark‘ – ein Hoch auf den Euphemismus. Hmmm – was hältst du von ,Volkspark‘?“
Bärdel wußte, wie gefährlich sein Spiel war – schließlich stand auch ,Hagenbecks Tierpark‘ fettgedruckt auf der Karte, und dumm war Manfred wahrlich nicht. Aber Manfred ließ sich zum Glück irreführen.
„Prima, Papa!“ jubelte er. Da steht es ja: „‘Volkspark‘. Also steigen wir jetzt in die S 21, was immer das auch ist, und schwuppdiwupp sind wir da.“
Dumm war Manfred wahrlich nicht.
Nach ein paar Stationen mit der S-Bahn stand die Familie auf der Schnackenburgallee. Genauer gesagt: Sie versuchte, dort zu stehen. Tatsächlich nämlich wurde sie herumschubst von tausenden von Menschen, die etliche Gemeinsamkeiten hatten: Sie waren jung und männlich, trugen trotz der sommerlichen Wärme Mützen und Schals in Weiß und Blau, grölten laut und unmelodisch im Chor und waren nicht mehr nüchtern, ein Zustand, den sie durch exzessive Benutzung zahlloser Bierflaschen und -dosen zu vertiefen versuchten. Alle strömten in dieselbe Richtung, und die kleinen Bären konnten sich ihrem Sog nicht entziehen. Sie wurden einfach mitgerissen.
Alle drei hatten Mühe, nicht in Panik zu geraten. Bären sind nun einmal gemütliche Leute, die alles Laute verabscheuen und die Langsamkeit lieben. Zudem haben sie gelernt, den Menschen aus dem Weg zu gehen, um ihre Ruhe zu haben. Aber hier konnten sie niemandem aus dem Weg gehen, es gab einfach keinen Platz dafür. Es gab noch nicht einmal genügend Platz, um zu sehen, wohin sie gedrängt wurden.
Tumu griff mit der rechten Pfote nach Bärdel und suchte mit der linken nach Manfred. Gut, hier mußten sie sich wohl erst mal eine Weile mitziehen lassen, bis sich irgendwann eine Chance ergab, sich aus dem Pulk zu lösen. Währenddessen aber wollten sie sich wenigstens nicht trennen lassen.
Bärdel drückte ihre Rechte beruhigend, aber ihre Linke blieb leer. Wo war Manfred?
„Halt!“ sagte Tumu.
„Das geht leider gerade nicht“, versuchte Bärdel zu scherzen.
„Es muß aber“, meinte Tumu, und Bärdel hörte aus ihren Tonfall, daß es ernst war. „Manfred ist weg!“
„Heilige Tussi“, murmelte Bärdel. Ein Mensch hätte jetzt vermutlich ‚Scheiße‘ gesagt. Und dann seufzte er: „Also los, kugeln!“
Bären verfügen über eine wirkungsvolle Technik, die dazu geeignet ist, selbst eine Stampede zu überleben. Sie rollen sich zusammen und spannen all ihre Muskeln an. Auf diese Weise können sie alle Tritte und Püffe überstehen, ja, sie können sich, während die Büffelherde oder was auch immer über sie hinwegstapft, sogar noch langsam vorwärtsbewegen. Ganz ohne blaue Flecke geht es dabei jedoch nicht ab. (Evolutionsbiologisch ist nicht ganz klar, wozu diese seit Urzeiten vorhandene Fähigkeit der Bären dient. Bären, Büffel und überhaupt alle Tiere sind einander immer klug aus dem Weg gegangen. Früh eine Fähigkeit zu entwickeln, für die erst in einer späten Phase der Evolution – nämlich mit dem Auftauchen des Homo sapiens sapiens – Bedarf besteht, widerspricht allen Grundsätzen des Darwinismus. Kennten Theologen das Problem, würden sie sich sicher damit beschäftigen.)
Bärdel und Tumu kugelten. Die Menschen über ihren angespannten Körpern fluchten über die Hindernisse, über die sie stolperten, und versetzten ihnen manchen schmerzhaften Tritt mit stahlbewehrten Stiefelspitzen, aber sie kamen voran. Nach wenigen Metern lagen sie vor einem viereckigen Loch. Vorsichtig hob Bärdel den Kopf.
Tumu tat es ihm nach.
„Ob Manfred da reingefallen ist?“ fragte sie.
„Möglich. Er kann aber auch abgedrängt worden sein, bevor du ihn anfassen konntest.“
„Nein. Er ist da unten. Ich spüre das!“
Bevor Bärdel eine Chance hatte, etwas zu sagen oder zu tun, war Tumu in das Loch gesprungen. Er schob sich ein Stück vor und lauschte in den schwarzen Schacht hinunter. Nichts. Was sollte er tun?
Er holte tief Luft und sprang hinterher.
Nur zwei oder drei Meter mußte er in freiem Fall verbringen, dann traf sein gut gepolsterter Hintern auf Beton. Auf einer steilen schiefen Ebene sauste er abwärts. Wo würde er landen? Wahrscheinlich in der Kanalisation. Vorsorglich hielt er sich die Nase zu. Einerseits war das eine scheußliche Idee – Bären haben einen hochentwickelten Geruchssinn, und Manfred, Tumu und er würden Wochen brauchen, um ihren Pelz so gründlich zu säubern, daß sie sich selbst wieder riechen konnten. Andererseits würden sie mit Hilfe der Kanalratten auch wieder aus dem stinkenden Verdauungstrakt der Stadt herausfinden. Aber wenn seine Vermutung stimmte, müßte er eigentlich Verwesungsgeruch wahrnehmen – und das war nicht so. Stattdessen sah er einen hellen Lichtschein.
Bruchteile von Sekunden später landete er unsanft, aber unverletzt. Vor ihm standen Tumu und Manfred.
„Tussi sei Dank,“ murmelte er und rappelte sich auf. „Konntest du denn nicht aufpassen?“ raunzte er Manfred an. „Wo sind wir hier überhaupt?“
„Ich habe aufgepaßt, aber jemand hat mich geschubst, und da bin ich gefallen. Wo wir sind, weiß ich nicht. Gerade als ich anfangen wollte mich umzusehen, kam Mama, und direkt danach bist du runtergepurzelt.“
Fast schämte Bärdel sich ein bißchen: Die sachliche Antwort seines Sohnes war viel bärischer als sein eigenes unbeherrschtes Verhalten. Aber auch Bärenvätern fällt es schwer, sich zu entschuldigen, und deshalb meinte er nur: „Na, dann wollen wir mal sehen, wie wir hier wieder rauskommen!“
Eine Untersuchung ihrer Umgebung machte die drei Bären auch nicht schlauer. Über ihnen war die Schwärze des Schachtes, durch den sie heruntergefallen waren. Ein kühler Luftzug wehte sie von oben an. Sie befanden sich in einem schmalen Tunnel, dessen Ende nicht zu erkennen war. Wandten sie sich nach links, kümmte er sich nach rechts; schauten sie nach rechts, nahmen sie eine Linkskrümmung wahr.
„Möglicherweise eine kreisförmige Anlage,“ stellte Tumu fest, und ihre Begleiter nickten. Eine ,Anlage‘ war es zweifellos. Auf dem Boden des Gangs waren Schienen installiert. In der Nähe der Wand verlief eine wenige Zentimeter dicke Leitung, die aber nur über kurze Strecken sichtbar war. Viereckige und sechseckige Kisten in Rot, Blau und Gelb waren in kurzen Abständen über die Leitung gestülpt. Auf einem Bord kurz unter der Decke gab es eine Ansammlung von Kabelsträngen.
Falls Tumus Vermutung von einer kreisförmigen Anlage stimmte, dann waren Leitung, Kisten und Kabel ,innen‘. ,Außen‘ an der Wand hingen Kästen, die nichts zeigten außer einem Schlüsselloch und einer in den Gang gestülpten kleinen Glasblase.
„Komische Gegend!“ meinte Manfred. „Hast du so was schon mal gesehen, Papa?“
Bärdel hätte gerne ,Ja‘ gesagt, denn er hatte viel gelesen und war durchaus eitel, obwohl er es ungern zugab. Aber hier mußte er passen.
„Nie,“ gab er zu. „Und ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, wozu das hier dient. Aber eines ist klar: Menschen haben das gemacht. Manfred, unser Wochenendausflug wird erfolgreich. Wir lernen was über den Menschen!“
„Super!“ jubelte Manfred. „Laßt uns anfangen! Ein Gang ist dazu da, erforscht zu werden!“
Es schien völlig egal, in welche Richtung sie gingen, und deshalb folgten Tumu und Bärdel ihren Sohn, als er sich nach links wandte. Etwa hundert Meter wanderten sie geradeaus, dann machte der Gang eine Rechtskurve. Abgesehen von der Krümmung änderte sich an der Umgebung nichts.
Psychologisch verhalten sich Bären in einigen Beziehungen nicht anders als Menschen, auch wenn sie grundsätzlich vorsichtiger sind. Beide Spezies gewöhnen sich schnell an unbekannte Umgebungen und schließen aus der momentanen Abwesenheit von Gefahr auf deren Nichtexistenz.
Schon nach wenigen Minuten schlenderten die Drei durch den Tunnel, als seien sie zu Hause in Bärenleben, und unterhielten sich lautstark. Manfred genoß das Abenteuer, und Bärdel war sich inzwischen sicher, daß sie sich in einer ringförmigen, also überschaubaren Anlage befanden. Es galt nur noch, einen Ausweg zu finden – mit oder ohne Kanalratten. Tumu aber hatte sich einen Rest Skepsis bewahrt, sie lauschte nach wie vor mit aufgestellten Ohren auf ungewohnte Geräusche. Sie tat gut daran.
„Pssst!“ zischte sie plötzlich. Menschenmänner hätten das vermutlich als weibliche Hysterie abgetan und sich nicht darum gekümmert, aber Bärdel und Manfred blieben sofort wie versteinert stehen. Tumu legte die Pfote auf die Schnauze, dann legte sie sich selbst auf die Schienen. Die Vibration war deutlich, und jetzt hörten auch die Männer ein leises Sirren.
„Es kommt jemand!“
Sie konnten nicht ausmachen, in welche Richtung sich das Schienenfahrzeug bewegte, aber letztlich war das auch egal: Wenn es weiterfuhr, mußte es in einem Ring irgendwann bei ihnen vorbeikommen. Sie schauten sich um: Die Eltern auf der Suche nach einem Fluchtweg, Manfred auf der Suche nach einer Waffe. Manfred wurde fündig: Neben einem sechseckigen blauen Kasten lag ein Schraubenzieher. Tumu und Bärdel aber suchten vergeblich: Rechts und links waren nur türenlose Wände, und auf dem weit hinter ihnen liegenden Weg, auf dem sie hereingekommen waren, konnten sie nicht zurück.
„Na“, meinte Tumu ruhig, „dann bleibt uns nichts anderes übrig. Maßnahme Streichholz! Manfred, leg den blöden Schraubenzieher wieder hin!“
Bären können nicht nur beim Kugeln ihre Körper vor Knüffen und Püffen bewahren, sie können sich auch perfekt tarnen, indem sie sich lang und starr machen. Schon so mancher Jäger hat sie in dieser Pose für einen dicken Ast gehalten und ist achtlos auf der Pirsch an ihnen vorbeigeschlichen. Bis zu diesem Augenblick hätten die Bären sich allerdings nicht träumen lassen, daß sie diese Fähigkeit eines Tages brauchen würden, um als ein Kabel zu erscheinen.
Manfred hüpfte mühelos auf das Bord kurz unter der Decke, Bärdel half Tumu mit der altbekannten Räuberleiter-Technik und kletterte dann selbst hinterher. Sie streckten sich und verwandelten sich in ,Streichhölzer‘. Nur die Augen schienen noch zu leben.
Hier oben auf der Kabelablage konnten sie das Vibrieren der Schienen natürlich nicht mehr wahrnehmen, aber das Sirren wurde deutlich lauter. Etwas näherte sich.
Jetzt erst bemerkten sie, daß das Gefährt auf den Schienen nicht ununterbrochen unterwegs war, sondern zwischendurch stoppte. Nicht nur einmal, sondern häufiger. Als das Geräusch näher kam, hörten sie auch Laute in den Pausen. Es waren immer die gleichen: Zwei dumpfe Geräusche, ein metallisches Klicken, Scharren, dann wieder ein Klicken, und nach einer kurzen Pause abschließend wieder die beiden dumpfen Töne.
Erst als ihr ,Besucher‘ in Sichtweite war, konnten sie sich einen Vers darauf machen, wenn sie auch überhaupt nicht verstanden, was da vorging. In einem schienengeführten Elektrokarren saß ein Mann mit einem roten Schutzhelm auf dem Kopf. Immer, wenn er auf der Höhe eines Kastens an der Außenwand war, stoppte er sein Gefährt. Er stieg aus, ging zu dem Kasten, steckte einen Schlüssel hinein, drehte ihn und zog ihn wieder heraus. Wenn er das getan hatte, leuchtete die Glasblase an dem Kasten grün auf. Anschließend blickte der Mann sich aufmerksam um, bevor er zu seiner Elektrodraisine zurückging, und dann begann das Ganze von vorn.
Die Bären ließen ihn passieren und lösten sich erst aus ihrer Streichholzpose, als er außer Sicht- und Hörweite war.
„Was sollte das denn?“ fragte Manfred. Aber hierauf wußten auch seine Eltern keine Antwort und zuckten nur die Schultern. Letztlich hielten sie die Ereignisse für harmlos. Ihre Kenntnisse der menschlichen Konventionen sagten ihnen, daß grüne Lämpchen „keine Gefahr“ bedeuteten. Vielleicht hätten sie sich gewundert und wären unruhig geworden, wenn sie hätten bemerken können, was auf der anderen Seite des Ringes geschah.
Das Elektrovehikel war an einer Gittertür in der Außenwand angekommen. Der Fahrer stieg aus, ging durch die Tür nach draußen und verschloß sie hinter sich. Er wurde erwartet. Vier Männer in ebenfalls roten Schutzhelmen standen auf der anderen Seite. Sie hatten auch Schlüssel in der Hand. Fast zeitgleich steckten alle fünf ihre Schlüssel in fünf verschiedene Kästen und drehten sie. Fünf grüne Lämpchen leuchteten auf. Die Männer blickten einander befriedigt an und stellten ein leuchtend rotes Schild vor die Tür, bevor sie sich entfernten.
Doch davon wußten die Bären nichts.
Nach der Störung setzten sie ihren Erkundungsgang fort. Nichts hatte sich geändert, außer daß an der Außenwand jetzt ab und zu eine Glühbirne hinter grünem Glas brannte. Gespannt steuerten sie auf die nächste Kurve zu: Ob sich dahinter wohl etwas ändern würde?
Neugierig pirschte Manfred vorweg. Bärdel hatte ihm versprochen, daß sie etwas über die Menschen lernen würden, und er wollte der erste sein, der das Neue entdeckte. Das gelang ihm eher, als ihm lieb war. Etwas hob ihn plötzlich von den Füßen und ließ ihn mit unwiderstehlicher Gewalt auf einen gelben Kasten zusausen. Unsanft rumste er dagegen und blieb daran kleben. Obwohl er ein mutiger Jungbär war und Selbstbeherrschung gelernt hatte, konnte er nicht verhindern, daß er zuerst „Scheiße“ sagte und dann „Hilfe“ rief.
Tumu wollte ihm sofort nacheilen, aber Bärdel erwischte sie noch gerade rechtzeitig am Nackenpelz.
„Stop!“ sagte er. „Manfred hängt fest, aber sonst scheint ihm nichts zu fehlen. Vielleicht kriegen wir ihn zusammen los. Wenn du ihm allerdings nachläufst und auch von diesem merkwürdigen Kasten angezogen wirst, weiß ich nicht, ob ich euch beide werde befreien können. Also laß uns erstmal nachdenken.“
‚Nachdenken‘ hieß primär, Manfred zu befragen. Er berichtete das, was sie zum großen Teil selbst sehen konnten: Der gelbe Kasten hielt ihn am Hinterteil fest. Arme und Beine konnte er frei bewegen, aber auch mit der größten Anstrengung konnte er sich nicht von der Metallkonstruktion abstemmen.
„Manfred“, fragte Tumu, und ihre Stimme klang, als ob sie sich an etwas erinnere, „was hast du am Hintern?“
„Eigentlich nichts“, bekam sie zur Antwort. Die Stimme klang kleinlaut. „Nur den Schraubenzieher, den ich vorhin gefunden habe.“
„Wirf ihn weg!“ befahl Tumu.
Manfred begann sich zu winden. Es ist nicht leicht, einen zwanzig Zentimeter langen Gegenstand aus der Kimme zu entfernen, wenn beide Arschbacken fest an der Wand kleben. Tumu beobachtete seine vergeblich erscheinenden Bemühungen. Sie schienen aussichtslos. Sie setzte sich in Bewegung, um ihm zu helfen.
„Halt!“ befahl Bärdel.
Zornig blitzte Tumu ihn an. Welch herzloser Vater! Wie konnte er die Leiden seines Sohnes verlängern wollen! Sie beschloß, seinen Befehl zu ignorieren.
„Halt!“ Dieses Mal klang es so energisch, daß selbst Tumu einhielt. Aber sie spürte, daß ihre angestaute Aggression sich in einer Schimpfkanonade entladen mußte. Sie holte tief Luft, aber Bärdel kam ihr zuvor.
„Zum dritten Mal: Halt! Wenn es dieser Schraubenzieher ist, der Manfred an der Wand festhält, dann haben wir es mit Magnetismus zu tun, und wenn du ihn anfaßt, dann hängst du vielleicht genauso fest wie er. Er muß es allein schaffen!“
Tumu erinnerte sich an die Menschenmärchen von Sindbad dem Seefahrer, in denen der Magnetberg eine große Rolle spielte, und verstand. Sie blieb stehen.
Manfred, der den Dialog seiner Eltern verfolgt hatte, begriff. Er mußte seinen Körper so bewegen, daß er den Kontakt zu dem metallenen Schraubenzieher verlor. Angesichts seiner gegenwärtigen Position hieß das: Er mußte an dem gelben Kasten senkrecht hochrobben.
Er versuchte es. Es war gar nicht so schwer, wie er gedacht hatte. Immer wenn ihn die Kräfte verließen, konnte er sich auf ,seinem‘ Schraubenzieher ausruhen, den er nach jedem Klimmzug ein Stückchen tiefer spürte.
Bärdel beobachtete sein Fortkommen genau. Als er schätzte, daß Manfred sich beim nächsten Aufwärtszug von dem Schraubenzieher lösen würde, kommandierte er:
„Zieh! Und spring!“
Manfred tat, wie ihm geheißen, und landete sicher auf dem Boden des Ganges. Einsam klebte der Schraubenzieher an dem gelben Kasten.
„Puh“, sagten alle Drei wie aus einem Mund. Die Ohrfeige, die Manfred erwartet hatte, blieb ihm erspart – seine Eltern waren viel zu erleichtert, um ihn zu bestrafen. Ein neues Abenteuer ihres vorwitzigen Sohnes wollten sie allerdings nicht riskieren. Manfred bekam die strikte Anweisung, hinter seinen Eltern zu bleiben, und da ihm der Schreck noch in den Knochen steckte, hielt er sich sogar daran.
Vorsichtig tappte jetzt Bärdel voran. Dichtauf folgten Tumu und Manfred – allerdings nicht auf Plüschfühlung. Zwar hatte jetzt keiner von ihnen mehr etwas Metallenes an sich, aber vielleicht gab es vor ihnen noch eine unbekannte Gefahr, die alles erfaßte, was miteinander Kontakt hatte.
Sie befanden sich in einer starken Krümmung des Ganges. An der Einrichtung hatte sich nichts verändert. Vor ihnen allerdings schien die Sonne aufzugehen. Ein gleißender Lichtschein drang hinter der nächsten Biegung hervor. Bärdel ließ sich davon wenig irritieren: Licht, dachte er, kann mir nichts anhaben. Ungeschützt trat er in den vollen Strahl.
Nein, vor ihm ging nicht die Sonne auf. Vor ihm erstrahlte ein Stern, tausendmal heller und farbenprächtiger als die harmlose, ferne kleine Sonne. Er leuchtete nicht nur in dem Gelbweiß des heimischen Gestirns, sondern in allen Farben des Regenbogens und noch in vielen mehr, für die Bärdel keine Namen gewußt hätte, selbst wenn er lange Zeit gehabt hätte, sie zu suchen.
Aber er hatte keine Zeit. Der Lichtstrahl war nicht nur unbeschreiblich schön und farbenprächtig, er war auch unerträglich heiß. Bärdel spürte, daß sein Plüsch in Flammen aufgehen würde, wenn er hier auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu lange verharrte. Wohin?
Zurück konnte er nicht. Tumu stand ihm fast auf den Hinterpranken, und ebenso dicht hinter ihr war vermutlich Manfred. Der Gang war so eng, daß alle drei hätten zurückgehen müssen, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen. Erklärungen, Befehle? Dauert alles viel zu lange. Umrennen? Funktioniert nicht.
Bärdel spurtete los – und war verschwunden.
Tumu erstarrte. Eben waren sie noch vorsichtig, aber gleichmäßig langsam vorwärtsgetrottet, und plötzlich war Bärdel weg. Manfred, der nichts sehen konnte, stupste sie ungeduldig in den Rücken.
„Was ist los?“
„Papa ist weg!“
Manfred schossen Gedanken über hysterische Frauen durch den Kopf, die er aber wohlweislich für sich behielt.
„Das kann doch gar nicht sein! Laß mich mal sehen.“
In ihrer Verwirrtheit unternahm Tumu nichts dagegen, daß Manfred sich an ihr vorbeidrängelte. Tatsächlich – kein Bärdel, nur ein sehr heller Lichtschein hinter der nächsten Kurve. Vorsichtig ließ er sich nach Art der Bärenvorfahren auf alle Viere nieder, schob sich langsam vorwärts und steckte den Kopf um die Ecke. Blitzschnell zog er ihn wieder zurück.
„Was ist da?“ wollte Tumu wissen.
„Licht. Und viel Hitze.“ Manfred hielt seinen heißen Kopf in den Tatzen. Wenn sein Vater da vorne war, war er entweder verbrannt, oder er hatte einen Ausweg gefunden. Aber es gab doch keinen Ausweg aus diesem Gang… Also mußte Bärdel in Flammen aufgegangen sein.
Haltlos begann Manfred zu weinen: „Mama, Papa ist tot! Und wir sind hier gefangen!!“
Tumu nahm ihn in den Arm. Zwar hatte auch sie Angst, aber die war nicht stark genug, zwei ihrer wesentlichen Fähigkeiten zu zerstören: Intuition und Denkfähigkeit. Sie ahnte, was ihrem Sohn durch den Kopf schoß.
„Der Gang muß einen Ausgang haben. Woher sollte sonst vorher der Mann gekommen sein, der mit dem Schienenfahrzeug unterwegs war? Glaubst du, der fährt hier immer im Kreis? Und wenn Papa verbrannt wäre, würden wir es riechen – verbrannter Plüsch stinkt entsetzlich!“
Manfred schämte sich – er hatte die Nerven verloren, und das vor einer Frau! Aber insgeheim war er stolz auf seine Mutter. Er wischte sich die Augen trocken und nickte.
Tumu sah, daß er wieder imstande war zu denken.
„Was genau hast du gesehen?“ wollte sie wissen.
„Der Gang da vorne krümmt sich immer weiter nach rechts. Irgendwo da vorne ist eine Lichtquelle, die strahlt stärker als zehntausend Sonnen. Und sie ist so heiß, daß…“
„Stop!“ sagte Tumu. „Wenn die Lichtquelle rechts ist und Papa nicht verbrannt ist – was er nicht ist – dann muß er nach links gelaufen und ihr ausgewichen sein. Nach links oder vielleicht auch geradeaus – jedenfalls immer an der linken Wand lang. Da muß ein Ausgang sein!“
Manfred nickte. In wortlosem Einverständnis machten beide kehrt und gingen zehn Schritte zurück. Dann drehten sie sich wieder um. Tumu faßte Manfreds rechte Hand und stellte sich schräg vor ihn. Gleichzeitig spurteten sie los.
Der Lichtstrahl machte sie blind, sobald sie in ihn eintauchten, aber Manfred hatte in dem jetzt etwas breiteren Gang zu seiner Mutter aufgeschlossen und leitete sie, indem er seine linke Pfote an der Wand entlanggleiten ließ. Blitzschnell durchquerten sie so die gefährliche Strahlung. Da Tumu ihn mit ihrem Körper abschirmte, bemerkte Manfred kaum etwas davon, Tumu dagegen hatte das Gefühl, halbseitig gegrillt worden zu sein.
„Da seid ihr ja endlich!“ Die Worte waren dürr, aber aus Bärdels Ton sprach unendliche Erleichterung. Zärtlich breitete er die Arme aus, aber Tumu wehrte ab.
„Später! Jetzt müssen wir erstmal sehen, wo wir gelandet sind!“
Die Bären standen in einer Art geradem Stichkanal, in dem es unnatürlich, aber nicht unerträglich warm war. Das tödliche Licht hinter ihnen drang hier nicht hinein. Vor ihnen war der Gang verschlossen, aber das war nur eine Art Fliegengitter ohne Schloß, einseitig an einem Scharnier befestigt.
„Na, dann wollen wir uns mal britisch verhalten“, meinte Bärdel.
„Hä?“ machte Manfred.
„Forward ever, backward never!“ schmunzelte sein Vater, ging voran und öffnete das Gitter.
Unbehelligt gelangten die Drei hindurch und kamen in eine große, mit häßlichen Dingen vollgestellte Halle. Kisten, Kästen, Apparaturen mit Skalen, Monitore und Schreibtische waren auf viele containerartige Gehäuse verteilt. Der Platz für all diese Geräte schien nicht auszureichen, so daß manche auf Emporen installiert waren, zu denen Treppen führten. Das sagte ihnen ein erster Orientierungsblick, dann aber fiel ihr Augenmerk auf das, was sie unmittelbar vor sich fanden.
Ein Mensch saß in seinem Gehäuse an seinem Schreibtisch und manipulierte die Schalter und Drehknöpfe etlicher Geräte.
„Oh!“ sagte Tumu. Sie war überrascht, so plötzlich vor einem Menschen zu stehen, und hatte den Laut nicht unterdrücken können.
„Ja, ja, da staunen Sie!“ antwortete der Mensch, ohne sich umzudrehen. „Ist schon phantastisch, was wir hier machen. ‚Zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.‘ Bald wissen wir’s. Glauben Sie bloß nicht, daß meine Forschung im Infrarotbereich dabei unwichtig ist. Alles ist wichtig. Ich meine festgestellt zu haben, daß Viren gerade bei diesen Wellenlängen…Moment mal!“ Er starrte auf seine Skalen, drehte wild an seinen Knöpfen. „Schade, doch nicht! Und ich dachte gerade…“ Er seufzte. „Meistens wollen die Teilchen anders als ich. Die Theorie ist gut, aber die Praxis funktioniert nicht. Haben Sie irgendwelche Fragen?“
Er wandte sich seinen Besuchern zu. Sein Blick traf auf eine Gruppe von drei vor Furcht erstarrten Plüschbären. Er strich sich über die Stirn, dann blickte er auf die Uhr.
„Sechs,“ murmelte er. „Jetzt kommen doch gar keine Besucher. Ich sollte doch mal eine Pause machen – wenn man anfängt, Plüschbären zu sehen, ist es höchste Zeit dafür.“
Sprach‘s, stand auf und ging.
„Und jetzt?“ fragte Manfred.
„Gehen wir“, antwortete Bärdel. „Ich kann mich den Worten dieses Herrn nur anschließen: Es ist höchste Zeit dafür.“
Unbehelligt spazierten die Bären durch die Halle und fanden den Ausgang. Unbehelligt gingen sie weiter über eine große Freifläche und fanden ein Tor. Als sie es passiert hatten, drehten sie sich um und lasen das Schild, das am Eingang prangte: Deutsches Elektronen Synchroton (DESY).
„Was war das denn nun?“ fragte Manfred, als sie nach kurzer U-Bahnfahrt wieder im Zug nach Bärenleben saßen und darauf hofften, daß niemand kam, um ihre nicht vorhandenen Fahrkarten zu kontrollieren.
„Hast du doch gelesen: Das war Daisy!“ scherzte Tumu.
„Danke! Wir waren also beim Gänseblümchen auf der Wiese, und vermutlich hat da auch noch ein Hasi gehockt, und ein Mädchen namens Petra oder Doris hat die Gänseblümchen gepflückt. Verarschen kann ich mich selber!“
„Drück ich nicht so vulgär aus!“ rügte Bärdel. „Wir wissen auch nicht, was das war. Aber wir haben bestimmt wieder etwas über den Menschen gelernt. Wir wissen nur noch nicht, was. Kommst du morgen mit in die Bibliothek?“
„Klar!“ Manfred stimmte begeistert zu.
Weihnachtsmärchen
„Papa„, sagte Manfred an einem Herbstabend, als die Bärensippe wie üblich in der Dämmerung zum Geschichtenhören zusammengekommen war, „erzähl uns heute doch das Märchen von Weihnachten!“
Aber Bärdel weigerte sich.
„Das ist kein schönes Märchen. Das ist eine Kriminalstory und ein Politthriller. Dabei kann man nur eine Gänsehaut kriegen. Nein, das mag ich Euch nicht erzählen.“
Manfred hatte zwar einigen Respekt vor seinem Vater, aber er wagte dennoch, ihm zu widersprechen.
„Weihnachten muß aber doch was Schönes sein! Du hast mir selbst erzählt, daß die Menschen sich auf Weihnachten freuen. Für viele ist es das schönste Fest des Jahres. Also kann es doch nichts Grausames sein. Bitte, erzähl doch!“
Auch die anderen waren jetzt neugierig geworden und drängten Bärdel zu beginnen.
„Also gut,“ seufzte er, „aber macht mich nicht dafür verantwortlich, wenn Ihr heute Nacht Albträume habt!“
„Es war einmal ein kleines Land, das von einer Großmacht besetzt war. Diese Macht wollte ganz genau wissen, was in ihrem Reich los war, und ordnete deshalb eine Volkszählung an. Das Ganze ist schon ziemlich lange her, und deshalb ist das Verfahren auch anders, als es in Dehland vor ein paar Jahren war. Man bekam nicht einfach einen Fragebogen, den man zu Hause ausfüllte und dann zum Amt für Statistik zurückschickte. Nein, man mußte sich persönlich an seinem Geburtsort melden.“
„Ganz schön umständlich!“ warf Tumu ein.
„Ja, umständlich und lästig. Und beschwerlich. Stell Dir mal vor, Tumu, Du solltest im neunten Monat zu Deinem Geburtsort trotten! Solche armen Frauen gab es natürlich auch – sie mußten allerdings nicht zu ihrem eigenen Geburtsort, sondern zu dem ihres Mannes. Schließlich galten sie als sein Eigentum.“
Bärdel sah, daß Tumu tief Luft holte, um eine geharnischte feministische Erklärung abzugeben. Deshalb fuhr er schnell fort – das Märchen von Weihnachten war schrecklich lang, und er wollte sich nicht schon am Anfang dauernd unterbrechen lassen.
„Das war damals halt so. Manche Orte waren wegen der Volkszählung hoffnungslos überfüllt, Hotels und Fremdenzimmer waren ausgebucht, und viele Menschen, auch hochschwangere Frauen, fanden nur notdürftig Unterkunft. Von einer, Maria hieß sie, wird erzählt, daß sie in Bethlehem ihr Kind in einem Viehstall zur Welt bringen mußte.“
„Das ist ganz schön traurig und zeugt nicht gerade von bärenmäßigem Umgang der Menschen miteinander, aber wo ist dabei der Krimi?“
Die Frage kam aus dem Hintergrund der Höhle, von daher, wo die ganz alten Bären lagerten.
„Der Krimi kommt gleich. Oder besser: der Politthriller. Die Großmacht hatte in den von ihr besetzten Gebieten Marionettenherrscher eingesetzt. Die hatten natürlich politisch nichts zu sagen, aber sie lebten in Reichtum und machten deshalb, was die Besatzer verlangten. Zu dem König‘ unseres kleinen Landes kamen in den Tagen der Volkszählung drei Besucher. Da sie von hohem Rang zu sein schienen, wurden sie sofort empfangen und bewirtet. Was sie wollten, erzählten sie sofort: Sie suchten den neuen König des Landes und fragten, wo er zu finden sei. Sie behaupteten, eine Vision gehabt zu haben – das müssen wohl Gurus oder Sektenführer gewesen sein.“
„Jetzt wird’s spannend!“ sagte Manfred und griff sich einen Zweig Holunderbeeren, von dem er genüßlich eine nach der anderen abzupfte.
„Ja, jetzt wird’s spannend. Aber paß bloß auf, daß Dir der Appetit nicht vergeht. Der König‘ hatte noch nie etwas von einem neuen König‘ gehört, aber er spürte sofort die Bedrohung. Vorsichtig horchte er seine Besucher aus, und die erzählten ihm, daß sie nach einem Neugeborenen suchten. Daraufhin befahl er kurzerhand, alle Säuglinge in seinem Land umzubringen.“
„Das muß die Volkszählung aber heftig durcheinander gebracht haben,“ murmelte Manfred und futterte die nächste Beere.
„Verrohte Jugend!“ schimpfte Tumu. „Kann Dich denn nichts erschüttern? Das waren doch Kinder!“
„Menschenkinder.“ Mehr sagte Manfred nicht.
Tumu beherrschte sich. Ein pädagogisches Gespräch mit ihrem Sohn war unbedingt notwendig, konnte aber warten. Jetzt sollte Bärdel weitererzählen.
„Und was passierte mit Marias Kind?“ fragte sie.
„Das wurde natürlich gerettet. Sonst wüßten wir ja auch nichts von ihm. Die Eltern des kleinen Jesus bekamen Wind von der Mordaktion und konnten ins Nachbarland fliehen. Dort blieben sie, bis sich alles wieder beruhigt hatte.“
„Bekamen sie politisches Asyl?“ wollte Manfred wissen. Offenbar hatte er sich vorgenommen, den heutigen Erzählabend nach Kräften in die Länge zu ziehen.
„Nein, so etwas gab es damals noch nicht. Sie müssen Geld gehabt und als Touristen gereist sein. Die Überlieferung ist da übrigens widersprüchlich: Jesus‘ Vater soll ein einfacher Handwerker gewesen sein und konnte sich bestimmt keine Urlaubsreise leisten. Wie dem auch sei: Angeblich wurde das Kind geboren und als einziges seines Landes gerettet. Das ist das Märchen von Weihnachten.“
Von allen Seiten erhob sich Protest.
„Das kann doch nicht alles sein!“
„Und deshalb feiern die Menschen Weihnachten?“
„Den Menschen ist ein einzelnes Kind doch völlig egal!“
Bärdel seufzte. Er hatte es geahnt. Sein Versuch, die Sache einfach darzustellen, mußte scheitern.
„Es war so, wie ich es erzählt habe. Es gibt da nur noch eine Kleinigkeit: Manche Menschen glauben, daß dieses Kind Jesus der Sohn Gottes war – oder ist.“

„Welcher Unsinn!“
„Wie kann ein Gott einen Sohn haben?“
„Wen hat er denn gefickt?“ Das war Manfred, zum Glück so leise, daß selbst Tumu es nicht hörte.
Energisch wehrte Bärdel ab.
„Nein, nein und nochmals nein. Wenn Ihr eine theologische Diskussion führen wollt – bitte, ohne mich. Hier interessiert nicht, ob die Menschen etwas Vernünftiges glauben, sondern daß sie es glauben. Basta!“
Jetzt brummten alle zustimmend. Als Märchenerzähler hatte Bärdel recht.
„Und?“ fragte Manfred. „Wie geht die Story weiter?“
„Wieso?“ antwortete Bärdel möglichst unschuldig. „Das Märchen von Weihnachten ist zu Ende.“
„Papa!“ sagte Manfred. „Kann ja sein, daß das Weihnachtsmärchen zu Ende ist. Aber Du kannst uns doch nicht hier sitzen lassen mit einem frisch geborenen Gottessohn! Da muß doch noch was kommen – Wunder, Seelenwanderung, Nirvana…“
Obwohl Manfred noch ein junger Bär war, stimmten ihm jetzt auch die ganz alten zu.
„Erzähl weiter!“ tönte es von allen Seiten.
„Also gut.“ Bärdel atmete tief durch. „Jesus war ein ziemlich normales Kind: Er hatte Freunde, er spielte mit Matsch, er spielte mit Tieren, er ärgerte seine Eltern ziemlich kräftig, und er riß ihnen auch aus, als er zwölf war. Seine Eltern erwischten ihn auf der Trebe, als er gerade ernsthaft mit Intellektuellen diskutierte – er muß entweder sehr intelligent oder altklug gewesen sein. Später aber lernte er brav von seinem Vater dessen Handwerk. Man weiß nichts Besonderes von ihm, bis er ungefähr dreißig Jahre alt war.
Da flippte er aus. Er radikalisierte sich und begann zu agitieren. Ein paar Leute brachte er auf seine Seite, während er sich von seinen Eltern entfremdete. Er hatte keine richtige Ideologie, aber worauf er hinauswollte, das war irgendwas zwischen Anarchie und Kommunismus. Er muß viel Charisma gehabt haben, denn es wird tatsächlich davon berichtet, daß er Wunder vollbracht habe.“
„Bestimmt hat er aus Brombeeren Brombeerwein gemacht!“ Natürlich war das Manfred.
„Nein, Du Naseweis, aber angeblich aus Wasser Wein. Allerdings war die Gesellschaft, die das behauptet hat, schon vor dem Wunder‘ ziemlich besoffen…
So verrückt und harmlos das Ganze eigentlich war, für die Mächtigen im Lande war er eine explosive Mischung aus Karl Marx und Ron L. Hubbard. Er mußte weg. Man engagierte einen V- Mann, der ihn ans Messer lieferte, machte ihm einen Schauprozeß, der Hitler oder Stalin alle Ehre gemacht hätte, und verurteilte ihn zu einer grausamen Todesstrafe. Unmittelbar nach dem Urteil wurde er exekutiert.“

„Und was ist jetzt mit Gottes Sohn?“ wollte eine dicke Bärin wissen.
Bärdel hatte geahnt, daß ihm an diesem Abend nichts erspart bleiben würde.
„Jesus ist gestorben, aber angeblich wieder auferstanden. Sein Grab soll leer gewesen sein, und frühere Bekannte von ihm behaupteten, ihn nach seinem Tod quicklebendig auf der Straße getroffen zu haben.“
„Was soll denn der ganze Zirkus?“ Dem alten Bären, der diese Frage stellte, war anzuhören, daß er in seinem langen Leben noch nie so viel Unsinn gehört hatte.
„Manche Menschen behaupten, alles sei Gottes Plan gewesen. Gott habe seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit die Menschen, also Gottes Geschöpfe, ihn töten. Durch seinen Tod habe Jesus die Menschen von ihrer Sünde erlöst, die sie von der Urmutter der Menschen geerbt hätten.“
Die Bärenhöhle erzitterte. Kein Erdbeben war die Ursache, sondern homerisches Gelächter. Sie brauchten lange, um sich zu beruhigen. Immer wieder fing einer von neuem an zu kichern oder zu prusten, und er wirkte ansteckend wie ein Lachsack.
Auch nachdem die Lachorgie verebbt war, kehrte nicht die gewohnte Ruhe ein.
Statt ruhiger Schnarchgeräusche erfüllten Seufzer, Angstschreie oder Heiterkeitsausbrüche die Schlafhöhle.
Bärdel hatte recht gehabt: Das Märchen von Weihnachten ist eine Garantie für Albträume.
Der dicke Mann
Es war einmal ein dicker Mann, der rauchte mit Leidenschaft Zigarren (N.B.: Die Geschichte der Zigarre findest Du in Kulles Dissertation). Das hatte er nicht immer tun können: Als er heranwuchs, herrschte in seinem Land Hunger, und es gab bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Männer mit und ohne Uniform erschossen und erschlugen einander. Man nannte das Wahlkampf. Als diese Zeit vorbei war, sorgte ein kleiner Mann mit einem Schnauzbart dafür, daß viele Menschen plötzlich verschwanden und die übrigen in Ruhe leben und arbeiten konnten – weil sie das konnten, kümmerten sie sich nicht um die Verschwundenen. Das dauerte aber nur ein paar Jahre. Danach fing der kleine Mann einen großen Krieg an, und an dessen Ende lag alles in Schutt und Asche.
Der dicke Mann war damals ganz dünn und hatte Hunger wie alle anderen auch. Aber er verbrachte seine Zeit nicht nur damit, Lebensmittel zu besorgen, sondern er dachte auch über etwas nach. Wie konnte man erreichen, daß es nie mehr zu Verhältnissen kommt, wie er sie erlebt hatte?
Als er jung gewesen war, hatten zwei Männer behauptet, eine Antwort auf diese Frage zu wissen. Ein Herr Schmidt aus England sagte, der Markt regle alles zum Besten aller, und ein Herr Marx aus Deutschland vertrat genau den entgegengesetzten Standpunkt.
Er war mit keiner Antwort zufrieden.
Er suchte nach einem Mittelweg.
Und er hatte Glück.
Obwohl er im Morgent(h)au unterwegs war und mit nichts Gutem rechnete, fiel ihm wie dem Sterntalermädchen ein großer Geldsegen in den Schoß. Diesen Schatz verstreute er über den Schutt und die Asche der Nachkriegszeit, und siehe, neues Leben wuchs aus den Ruinen. Fabrikschornsteine begannen zu rauchen, und in den Fabriken arbeiteten entlassene Soldaten. Häuser wurden wieder aufgebaut, und nach Feierabend kauften die Arbeiter Tapeten und Linoleum für ihre neuen Wohnungen.
Geld heckte Geld. Die Taschen der Fabrikbesitzer und Bauherren füllten sich. Freude herrschte unter ihnen, und sie lobten den dicken Mann, dessen Schatz die Grundlage für ihren neuen Reichtum war.
„Halt!“ sagte da der dicke Mann. „Es ist schön, daß ihr gut verdient, aber ihr sollt nicht alles von eurem Gewinn behalten dürfen. Wohlstand für alle! Auch eure Arbeiter, auch die Alten, auch die Arbeitsunfähigen sollen auskömmlich leben können. Ich will nämlich nicht, daß es noch einmal zu einem Bürgerkrieg kommt, wie ich ihn in meiner Jugend erlebt habe.“
Die Fabrikbesitzer und Bauherren guckten skeptisch. Da flüsterte der dicke Mann, der sich unbeobachtet wußte, ihnen noch zu: „Und ich will auch nicht, daß sich die Ideen eines gewissen Herrn Marx durchsetzen.“
Das überzeugte seine Zuhörer.
Es fiel den reichen Herren leicht, aus ihren gefüllten Taschen ein wenig abzugeben. Jedes Jahr wurde ihr Schatz größer. Immer mehr Fabrikschornsteine rauchten, und die Arbeiter kauften inzwischen nicht nur Tapeten und Linoleum, sondern auch Teppiche, Kühlschränke und sogar Autos.
Eines allerdings störte die Herren ein wenig: Der dicke Mann hatte etwas dagen, daß sie untereinander ihre Fabriken und Baufirmen aufkauften. Er wollte so, wie er sagte, „Marktmacht“ verhindern. Nun gut. Sie zuckten nur die Schultern und schlossen eben, solange sie den dicken Mann noch fürchten mußten, ihre Verträge heimlich ab. Wie konnte er nur so dumm sein und glauben, sich einem Gesetz des Marktes entgegenstellen zu können?
Der dicke Mann hatte es nicht nur mit den großen Herren der Wirtschaft zu tun, sondern auch mit den kleinen Leuten. Die liebten ihn, denn sie glaubten es ihm zu verdanken, daß sie in ihren Wohnungen auf Teppichen gingen und im Auto zur Schicht fuhren. Sie wählten ihn deshalb immer wieder an die Macht, und so hatten auch die Wirtschaftsherren – zumindest öffentlich – Respekt vor ihm.
Der dicke Mann war es zufrieden und blies aus seiner Zigarre formvollendete Rauchringe in die Luft.
Die Wirtschaftsherren schlossen heimlich weiter Verträge miteinander und warteten auf ihre Stunde.
Die Stunde kam.
Die Bilanzbuchhalter waren bereit.
Ihr Material war perfekt: Sinkendes Wirtschaftswachstum, steigende Energiepreise, geringere Exporterfolge. Eine Hiobsbotschaft jagte die nächste. Die Buchhalter waren gut geschult und errechneten rote Zahlen. Es gab nichts mehr zu verteilen. Sagten die Bilanzen.
Der dicke Mann mußte ihnen glauben. Er steckte in der Zwangsjacke. Viele Arbeiter waren entlassen worden und drohten, ihn nicht wiederzuwählen. Er wollte aber wiedergewählt werden. So erlaubte er den Wirtschaftsherren Zusammenschlüsse, weil ihm gesagt wurde, nur so seien weitere Entlassungen zu verhindern. Prompt folgten den Firmenhochzeiten weitere Entlassungen.
„Was soll ich denn jetzt noch tun?“ rief der dicke Mann verzweifelt.
„Du mußt deine Politik ändern!“ riefen ihm die Wirtschaftsherren zu. „Wohlstand für alle – was für ein Unsinn! Vielleicht könnte es gehen – wenn unsere Kosten niedriger wären. Alles wird von uns finanziert: der Lebensstandard der Arbeitslosen, der Rentner, und so weiter. Befreie uns davon, und wir können wieder Arbeiter einstellen!“
Der dicke Mann glaubte ihnen nicht recht, aber er hatte keine Wahl. Er tat, was sie wollten. Trotzdem wählten ihn die Arbeiter nicht wieder, denn es ging ihnen immer schlechter.
Wenn er jetzt durch die Straßen ging, versteckte er sich, anders als früher, hinter einer dicken Wolke Zigarrenrauch. Er wollte nicht erkannt werden, und er wollte auch nicht so richtig sehen, was sich ihm da demonstrativ und bescheiden zugleich entgegenreckte.
„Arbeitslos und obdachlos. Ich habe Hunger.“
Um sich vor dem Elend zu schützen, das ihn umgab, kaufte sich der dicke Mann eine Zeitung und begann zu lesen.
„Neue Produktion von Mercedes im Elsass“
„Bremer Vulkan meldet Konkurs an“.
Der dicke Mann nahm seine letzte Kraft zusammen und bat die Wirtschaftsherren des Landes zu einem Champagnerfrühstück. Zwar war er nicht mehr Regierungschef, aber er baute darauf, daß seine Bekannten kamen, und er hatte recht.
Als Begrüßung sagte er nur: „Prost!“, was alle Anwesenden zunächst verwirrte, dann aber erfreut zum Trinken animierte. Die meisten tranken ihr Glas auf ex, auch der dicke Mann. Da er am vorigen Tag nichts gegessen und in der darauffolgenden Nacht kaum geschlafen hatte, war er sofort ziemlich angeschickert. Auch auf viele Wirtschaftsherren wirkte der Alkohol. So waren alle ungewöhnlich ehrlich zueinander.
„Warum macht ihr das?“ fragte der dicke Mann alle, auf die er zusteuerte. Er steuerte übrigens auf alle zu.
„Rendite.“
„Gewinn.“
„Dividende.“
Der dicke Mann war nicht dumm. Er wußte, was hinter all diesen schönen Begriffen steckte: Geld.
Er startete einen letzen Versuch: „Und die Sozialbindung des Eigentums?“
Offenbar ging es seinem Gesprächspartner gerade schlecht, denn er antwortete nicht verbal, sondern mit einer akustisch deutlichen Verdauungsstörung.
Der dicke Mann verstand. Er verließ die Gesellschaft und erschoß sich mit seiner Zigarre.
Null Sekunden später war er im Raum der Nichtlebenden. Er hatte das dringende Gefühl, sich erholen zu müssen.
„Darf man hier rauchen?“ fragte er.
„Klar!“ erhielt er zur Antwort. Ein Pykniker mit wallender Mähne und Rauschebart hatte das gesagt. Der dicke Mann hielt es für höflich, sich vorzustellen.
„Ich bin…“
„Ich weiß“ kicherte der andere, „ich weiß, wer Sie sind. Entschuldigen Sie, aber so was Komisches…“
Und das Kichern wurde zu einem schollernden Gelächter, das durch die Äonen hallte.











